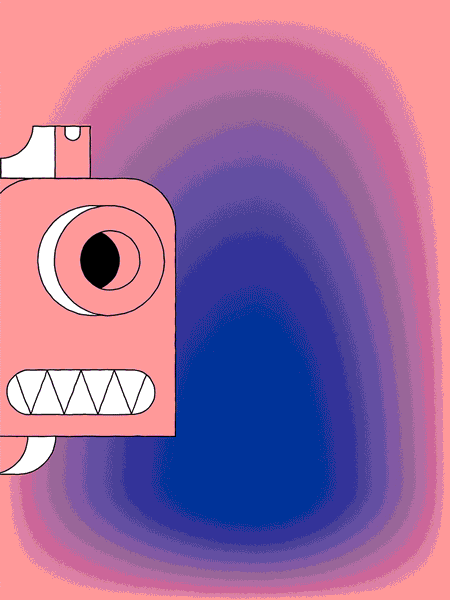
Voll ins Auge
Mindestens einmal pro Jahr wird in der Schweiz ein Mensch von einem Gummigeschoss schwer verletzt. Trotzdem setzt die Polizei oft und erstaunlich breit auf das umstrittene Einsatzmittel. Kritik daran gibt es kaum. Anders als früher.
Von Brigitte Hürlimann, Basil Schöni (Text) und Flacoux (Illustration), 01.12.2022
Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Lösen Sie jetzt ein Abo oder eine Mitgliedschaft!
In vielen Ländern sind Gummigeschosse verboten. Nicht aber in der Schweiz. Warum nicht? Wie, wo und warum werden sie eingesetzt? Und was sind die Folgen? Fachleute erklären. Und sieben Menschen erzählen ihre Geschichte.
«Mir wurde übel vor Schmerz»Claudio Massoni
Claudio Massoni hasst es, wenn er Eishockeyfan genannt wird. Dann wird der sonst so gefasste, schon fast schüchtern auftretende Mann ungehalten. Er sei doch nur an diesen elenden Match gegangen, weil er seine damalige Freundin begleitet habe.
Das war im November 2017. Ein Zürcher Derby. Der EHC Kloten gegen die ZSC Lions. Spielort Kloten. Das Stadion prall gefüllt. Familien, Fans, Kind und Kegel.
Der damals 26-jährige Mann, den wir Claudio Massoni nennen, wurde zusammen mit seiner Freundin von den Platzanweisern in den Gästesektor geführt. Die Lions gewannen mit 4:1. Die Freundin jubelte. Für Massoni aber fing kurz nach dem Abpfiff ein Albtraum an, der ihn bis heute verfolgt.
«Nach dem Match wurden ich und meine damalige Freundin von Sicherheitsleuten vom Stadion zurück an den Bahnhof Kloten eskortiert», sagt Massoni. Die Sicherheitsleute bestimmten die Route. An einer Kreuzung unweit des Bahnhofs warteten gegnerische Fans. Es kam zur Randale.
«Es herrschte Chaos», sagt Massoni. Er habe so rasch wie möglich weggehen wollen, zum Bahnhof, nach Hause. «Ich war ja nur an dieser Kreuzung, weil wir dorthin geführt worden waren.»
Plötzlich spürte Massoni einen Schlag ins Gesicht. «Mir wurde übel vor Schmerz, ich musste mich übergeben. Aus meinem rechten Auge floss Blut. Ich habe versucht, die Blutung mit der Hand und mit Taschentüchern zu stoppen. Erst danach realisierte ich, dass die Polizei Gummischrot eingesetzt hatte.»
Massoni schaffte es irgendwie auf den Zug, fuhr nach Zürich zu seinen Eltern, die ihn unverzüglich in die Notaufnahme des Universitätsspitals Zürich brachten. Massoni blieb die Nacht im Spital.
«Schwerste Contusio bulbi rechts» lautet die Diagnose. Das bedeutet: Eine schwere Augapfel- beziehungsweise Augenprellung infolge einer stumpfen, von aussen einwirkenden Gewalt.
Er habe selten eine derart gravierende Augenverletzung gesehen, sagt Augenchirurg Roman Eberhard, der Massoni damals behandelte und heute als Leitender Arzt am Zürcher Stadtspital Triemli tätig ist.
Ich will es genauer wissen: Wo kommen Gummigeschosse zum Einsatz
In der Schweiz werden Gummigeschosse vor allem im Ordnungsdienst eingesetzt, das heisst bei Demonstrationen, Fussballspielen und ähnlichen Ereignissen. Ob Kundgebungen bewilligt oder unbewilligt sind, macht für den Einsatz keinen Unterschied. Neben den Polizeien der Kantone und Gemeinden dürfen auch manche Bundesbehörden dieses Einsatzmittel verwenden.
Welche Behörden welche Werfersysteme und Munitionstypen verwenden und an welche Richtlinien sie sich dabei halten sollten, lesen Sie hier.
Viermal operierten die Ärzte Massonis rechtes Auge. Eine fünfte Operation steht bevor. Doch das verletzte Auge konnte nicht gerettet werden. Claudio Massoni ist heute auf einem Auge faktisch blind. Als Einäugiger sieht er nicht mehr dreidimensional. Seinen handwerklichen Beruf musste er an den Nagel hängen, derzeit lässt er sich im kaufmännischen Bereich umschulen. Jeden Tag hat Claudio Massoni Angst, auch das zweite Auge zu verlieren.
Doch Massoni will es nicht dabei bewenden lassen. Mit Unterstützung von Rechtsanwalt Philip Stolkin hat Massoni eine Staatshaftungsklage gegen den Kanton Zürich eingereicht. «Es geht mir um Gerechtigkeit», sagt Massoni, «und darum, dass keinem anderen passiert, was ich erlebt habe. Diesem Tun muss ein Ende gesetzt werden.»
Keine Zahlen, keine Statistiken – nur ein Dunkelfeld
Genau das gleiche Anliegen verfolgen auch Augenärztinnen. Unter ihren Berufskollegen tauche immer wieder die Frage auf, warum solche Geschosse nicht längst verboten seien, sagt die Zürcher Augenärztin Anna Fierz. Die Gefährlichkeit dieser Munition sei seit den Zürcher Jugendunruhen der frühen 1980er-Jahre bekannt – doch es sei still geworden rund ums Thema. Nur schon Fragen zu stellen, so Fierz, sei schwierig.
Im Namen der Arbeitsgruppe Prävention der Swiss Academy of Ophthalmology versuchte sie, Fälle von Augenverletzungen durch Gummigeschosse zu sammeln. Erfolglos. Die Arbeitsgruppe setzte sich deshalb im Fachmagazin «Ophta» für eine Meldepflicht ein.
«In einem Land mit demokratischer und rechtsstaatlicher Tradition muss die Erhebung dieser Daten möglich sein. Ohne Zahlen und Fakten lassen sich die offenen Fragen nicht vernünftig erörtern.»
Keine Zahlen, keine Statistiken – es gibt nur ein Dunkelfeld, das die Republik ausgeleuchtet hat: Wir haben alle deutschsprachigen Medienberichte der letzten zehn Jahre ausgewertet, die über Verletzungen durch Gummigeschosse in der Schweiz berichten – und punktuell auch ältere. Wir haben zudem mit Betroffenen gesprochen, mit Fachleuten, Anwälten und Polizistinnen. Wir haben interne Dienstbefehle, Weisungen, ballistische und medizinische Gutachten sowie Empfehlungen eines interkantonalen Gremiums gelesen, an denen sich die Polizeibehörden im ganzen Land orientieren. Viele Dokumente wurden uns allerdings vorenthalten.
Das Fazit: In den letzten zehn Jahren hat die Polizei in der Deutschschweiz mindestens zehn Menschen mit Gummigeschossen schwer verletzt. Es ist davon auszugehen, dass es noch weitere Verletzte gibt, die nie an die Öffentlichkeit gelangten.
Das ist bei den zehn Fällen geschehen:
Gummigeschosse werden in der Schweiz vor allem als Schrotmunition verwendet. Jeder einzelne Schuss besteht aus 28 bis 35 kleinen Projektilen aus Hartgummi. Die Polizei setzt sie ein, um randalierende Gruppen auf Distanz zu halten. Ausserdem gibt es sogenannte Wuchtgeschosse. Sie unterscheiden sich von der Schrotmunition dadurch, dass die Polizei auf eine bestimmte Person zielt (nicht auf eine Gruppe) und damit einen «Wirkungstreffer» erzielen will.
Diese Einsatzzwecke lassen sich einem Dokument entnehmen, das wir von PTI Schweiz, dem Kompetenzzentrum Polizeitechnik und -informatik, bekommen haben. Dabei handelt es sich um eine kaum bekannte, aber durchaus einflussreiche Organisation, die für die Harmonisierung von Polizeitechnik und Polizeiinformatik zwischen den Kantonen zuständig ist.
Das klingt harmlos. Bedeutet aber: Das Gremium prüft unter anderem die Waffensysteme, die Schweizer Polizeibehörden einsetzen – und empfiehlt, wie sie anzuwenden sind. Diese Aufgabe nahm vor der Gründung von PTI Schweiz die Konferenz der kantonalen Polizeikommandantinnen und -kommandanten (KKPKS) wahr. Weil gewisse Empfehlungen aus dieser Zeit stammen und die beiden Organisationen immer noch eng zusammenarbeiten, schreiben wir im Folgenden jeweils von «PTI Schweiz/KKPKS».
Zu den Waffensystemen, die PTI Schweiz/KKPKS evaluiert, gehören auch Gummigeschosse. Genauer: die vier Arten von Gummigeschossen, die in der Schweiz eingesetzt werden.
Die Polizisten müssen Mindestdistanzen von 5, 10 oder 20 Metern einhalten, wenn sie Gummigeschosse abfeuern – ausser bei Notwehr, aber dazu später mehr.
Mit den Wuchtgeschossen sollen die Schützinnen auf die Gürtellinie zielen, mit der Schrotmunition auf den Rumpf oder den Oberschenkel. Wobei: Das mit dem Zielen ist so eine Sache – besonders bei der Schrotmunition, die die Polizei weitaus am häufigsten einsetzt.
Je mehr Abstand der Schütze hat, desto breiter streuen die Gummischrotprojektile. Beim meistverbreiteten Gummischrottyp können sich die einzelnen Projektile bei einer Schussdistanz von 20 Metern auf einen Kreis von etwa 4 Metern Durchmesser verteilen.
Mit anderen Worten: Die Polizei kann unmöglich auf eine bestimmte Körperregion zielen und diese exakt treffen.
Gummischrot ist eine Waffe mit Flächenwirkung, die gegen Gruppen eingesetzt wird. Und deshalb verletzt sie immer wieder auch unbeteiligte Menschen.
Ein Einsatzmittel ohne gesetzliche Grundlage?
Claudio Massoni will trotz seiner schweren Augenverletzung zurück ins Alltagsleben finden. Er lernt einen neuen Beruf und kämpft gegen das Trauma, die Flashbacks und die Depressionen an. Das gelingt ihm oft, aber nicht immer. In einem neueren Arztbericht ist von einer chronifizierten posttraumatischen Belastungsstörung die Rede. Von Angstzuständen und Schweissausbrüchen, wenn er Polizistinnen begegnet. Und von Albträumen.
Nun will Massoni den Kanton Zürich mit einer Staatshaftungsklage zur Rechenschaft ziehen. Damit nimmt er einen langen, riskanten und kostspieligen Weg auf sich.
Der einäugige junge Mann verlangt Schadenersatz und Genugtuung. Und dass der Kanton Zürich für den Polizeieinsatz in Kloten geradestehen muss, also für die Handlungen seiner Beamten haftet. Rechtsanwalt Philip Stolkin hält im Namen von Massoni fest:
Der Gummigeschosseinsatz sei nicht notwendig gewesen. Die Schlägerei zwischen den rivalisierenden Fans habe schon zuvor beendet werden können – mit anderen und mit milderen Mitteln.
Der Einsatz habe auch friedliche Matchbesucher betroffen, die nach Hause gehen wollten. Das verstosse gegen den Grundsatz, dass sich polizeiliches Handeln gegen die Störer richten müsse – gegen jene Personen, die den «polizeiwidrigen Zustand» unmittelbar zu verantworten haben.
Die Polizisten hätten die Mindestdistanz von 20 Metern nicht eingehalten. Diese gilt immer – ausser bei einer Notwehrsituation. Und davon könne keine Rede sein.
Überhaupt fehle es für sämtliche Gummigeschosseinsätze an einer gesetzlichen Grundlage.
Dieses letzte Argument des Zürcher Rechtsanwalts birgt Zündstoff. Bekäme er recht, dürfte die Polizei künftig keine Gummigeschosse mehr einsetzen. Philip Stolkin betont die massive Verletzungsgefahr, die von Gummigeschossen ausgehe. Die Bundesverfassung und die Europäische Menschenrechtskonvention verlangten für solche Fälle eine klare und genügend bestimmte Regelung auf Gesetzesstufe. In einem kantonalen Gesetz bloss rudimentär festzuhalten, dass die Polizei «geeignete Einsatzmittel» gebrauchen dürfe, genüge nicht.
Ebenso wenig sei zulässig, den Einsatz von Gummigeschossen in Verordnungen, Dienstreglementen, internen Weisungen oder Einsatzbefehlen zu regeln. «Die gesetzliche Grundlage muss für jedermann zugänglich sein – nur so kann ein Machtmissbrauch verhindert werden», argumentiert Stolkin. Und da es an dieser Grundlage fehle, sei der Einsatz von Gummigeschossen widerrechtlich.
Das Verfahren vor dem Bezirksgericht Zürich läuft noch. Beide Seiten kämpfen mit harten Bandagen.
Verhältnismässig? Ansichtssache
Der Kanton Zürich stellt unter anderem infrage, ob die schwere Augenverletzung von Claudio Massoni überhaupt von einem Gummigeschoss stamme. Sie könne auch die Folge eines Sportunfalls sein, eines Sturzes oder eines Faustschlags; Ereignisse, die irgendwann hätten stattfinden können. Schliesslich habe sich der Betroffene mit seiner Augenverletzung nicht sofort an die Polizei gewandt. Erst durch die Staatshaftungsklage habe man davon erfahren. Monate später.
Und sollte Massoni doch durch ein Gummigeschoss verletzt worden sein, so die Argumentation des Kantons Zürich, dann sei Massoni selbst schuld. Der Polizeieinsatz sei notwendig und verhältnismässig gewesen und regelkonform verlaufen. Der Betroffene hätte sich ja nicht in der «Gefahrenzone» aufhalten müssen.
Interessant ist, dass sogar der Kanton Zürich von ein paar wenigen vermummten Fans spricht, die sich «besonders weit nach vorne» gestellt hätten. Sie hätten sich zwar nicht mehr geprügelt, aber Polizistinnen beschimpft.
Nur: Warum gingen die Grenadiere nicht gegen die paar Störerinnen vor, sondern schossen in die Menschenmenge, die ja an diese Kreuzung geführt worden war? Und ist eine Beschimpfung, so unflätig sie sein mag, Grund genug für einen Gummigeschosseinsatz?
Mit anderen Worten: Wer entscheidet darüber, wann, wie und warum Gummigeschosse eingesetzt werden?
Die Antworten finden sich vor allem in polizeiinternen Weisungen, Dienstanordnungen oder Schulungsunterlagen, die nicht öffentlich sind. Die kantonalen Polizeigesetze halten lediglich in groben Zügen fest, dass die Polizei zu «geeigneten Hilfsmitteln» oder «geeigneten Einsatzmitteln» greifen darf – unter Wahrung der Verhältnismässigkeit.
Etwas mehr Hinweise liefert der Kanton Basel-Stadt auf seiner Website: «Steht die Kantonspolizei einer grösseren Gruppe von Aggressoren gegenüber, kann sie mit dem Distanzmittel des Gummigeschosses diese Gruppe aus der Entfernung in Schach halten oder zurückdrängen, ohne physische Gewalt einzusetzen.»
«Ohne physische Gewalt» – das ist eine bemerkenswerte Bewertung von Gummigeschossen. Zumal sie regelmässig zu schweren Verletzungen führen. Wie zum Beispiel im Fall von Iwan S.
«Das dürfen sie doch nicht!»Iwan S.
Iwan S. war Schreiner, als er im September 2021 in Bern an einer unbewilligten Demonstration gegen Corona-Massnahmen teilnahm. Die Polizei wollte verhindern, dass sich der Umzug in Richtung Untere Altstadt bewegt – und setzte Gummigeschosse ein.
Macht es einen Unterschied, ob das Einsatzmittel an einer bewilligten oder einer unbewilligten Kundgebung eingesetzt wird?
Nein.
Die Voraussetzungen bleiben stets die gleichen. Eine «grösser Gruppe von Aggressoren» soll auf Distanz gehalten werden, um es nochmals in den Worten von Basel-Stadt auszudrücken. Wobei mehrfach dokumentiert ist, dass Gummischrot auch zu anderen Zwecken eingesetzt wird – dazu später mehr. Und was ebenfalls gilt, unabhängig, ob bewilligte oder unbewilligte Demonstration: Der Mitteleinsatz muss verhältnismässig sein. Und sich gegen die Störer richten. Sind mildere Mittel möglich, müssen diese eingesetzt werden.
Der damals 51-jährige Iwan S. wurde beim Gummischroteinsatz am linken Auge getroffen und sieht seither nur noch mit dem rechten.
Er habe weder randaliert noch Polizisten bedroht, sagt Iwan S. Er musste seinen Beruf aufgeben und wanderte mit seiner Verlobten nach Kambodscha aus. Von der Schweiz hat er genug. Am Telefon erzählt er, wie er um IV-Leistungen kämpfe. Wie aufwendig und mühsam das Prozedere sei. Die Opferhilfestelle habe ihm davon abgeraten, eine Strafanzeige gegen die Polizei einzureichen – das sei aussichtslos.
«Die Polizisten riefen uns damals zu, wir sollten stehen bleiben», erzählt Iwan S. «Darum blieb ich stehen.» Dann habe die Polizei einfach geschossen, auf eine unbewaffnete Menschengruppe. «Und aus einer Distanz von klar unter 20 Metern. Das dürfen sie doch nicht!»
Aber sie dürfen es. Und sie tun es häufig. In all diesen Fällen berufen sich die Polizisten auf eine Notwehrsituation. Dann gelten keine Mindestdistanzen mehr.
Und wann liegt Notwehr vor?
Von Notwehr ist die Rede, wenn jemand ohne Recht angegriffen wird oder wenn ein Angriff unmittelbar bevorsteht. So lautet die Definition im Strafgesetzbuch. Doch weder Iwan S. noch Claudio Massoni werden beschuldigt, Polizistinnen angegriffen zu haben.
Auch im nächsten Fall, dem von David Böhner, ist dies kein Thema.
«Ich wollte die Leute warnen»David Böhner
Böhner nahm im Dezember 2003 in Bern an einer unbewilligten Kundgebung gegen eine Armeefeier teil. Dort traf ihn ein Gummischrotprojektil ins Auge. Er musste sich zweimal operieren lassen und trägt heute eine künstliche Linse. Die Sehkraft am verletzten Auge beträgt noch rund 30 Prozent.
Böhner sagt, die Distanz von 20 Metern sei niemals eingehalten worden. Und von einer Notwehrsituation könne keine Rede sein. Einige Kundgebungsteilnehmer hätten an einem Absperrzaun gerüttelt und gelärmt. Er habe diese Leute vor den heraneilenden Grenadieren warnen wollen. Dann habe es geknallt.
Anders sieht das die Polizei: Sie habe einmal aus Notwehr «Gummi eingesetzt», heisst es im Einsatzjournal, das ähnlich einem Liveticker und minutengenau jedes nur erdenkliche Detail festhält. Die Demonstranten hätten Flaschen und Steine geworfen.
Was auffällt: Diese Begründung und der Verweis auf eine angebliche Notwehrsituation werden im Einsatzjournal nachgeliefert. Sie findet erst eine halbe Stunde nach dem Abfeuern von Gummischrot Erwähnung.
Dass Böhner Gegenstände gegen die Polizei geworfen oder sich sonst aggressiv aufgeführt hätte, behauptet niemand.
Böhner, der heute für die Alternative Liste im Berner Stadtparlament sitzt, reichte Strafanzeige gegen die Polizei ein. Der mutmassliche Schütze sagte dem Staatsanwalt bei einer Einvernahme, man halte bei Gummischrotübungen die Mindestdistanz von 20 Metern immer ein. Aus näherer Distanz werde nie geübt. Die Distanz habe man mit der Zeit im Griff, und gezielt werde immer auf den Rumpf.
Ähnliches schreibt der Kanton Zürich im Staatshaftungsfall von Claudio Massoni: Es werde auf Hüfthöhe gezielt. Also nicht auf die Beine, wie so viele meinen. Was auch Elias Weber mit schweren Folgen erleben musste.
«Ich hätte es nicht tun sollen»Elias Weber
Im Fall eines jungen Berners, den wir Elias Weber nennen, zielte die Polizei ebenfalls auf Hüfthöhe. Als es im September 2018 beim Kulturzentrum Reitschule zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Jugendlichen kam, warf er – sturzbetrunken – eine Flasche in Richtung Polizei. Sie traf eine Wand.
Dann schoss ein Polizist ein Wuchtgeschoss auf ihn. Es traf den Genitalbereich.
Das Geschoss zerriss Elias Weber einen Hoden. Trotz Notoperation starben drei Viertel des betroffenen Gewebes ab.
«Ich weiss, dass ich einen Seich gemacht habe», sagt Elias Weber heute. «Ich war stark betrunken und tat etwas, das ich nicht hätte tun sollen. Aber das rechtfertigt doch nicht, einem Menschen einen Hoden wegzuschiessen. Ich konnte die Flasche ja nicht mal mehr gerade werfen.»
Webers Fall ist brisant, weil die Polizei das tat, was das interkantonale Gremium PTI Schweiz/KKPKS empfiehlt: mit Wuchtgeschossen auf die Gürtellinie zielen. Also ungefähr dorthin, wo Elias Weber schwer verletzt wurde.
Warum also empfiehlt PTI Schweiz/KKPKS dieses Ziel?
Wuchtgeschosse sind Gummiprojektile, so gross wie ein Golfball, die gezielt auf einzelne Personen geschossen werden. Weil sie viel mehr Energie enthalten als die leichteren Gummischrotprojektile, bergen sie ein grösseres Verletzungspotenzial.
Vereinfacht gesagt hat ein Wuchtgeschoss direkt nach dem Abschuss etwa gleich viel Energie wie ein Objekt, das ein Kilogramm wiegt und aus 12 Metern Höhe auf den Boden prallt. Und auch auf 60 Metern Flugdistanz verliert es wenig Energie – nun prallt das ein Kilo schwere Vergleichsobjekt aus 8 Metern Höhe auf.
Das zeigt ein Bericht der Universität Bern im Auftrag des Munitionsherstellers, der der Republik vorliegt.
Bei einer Schussdistanz bis 30 Meter bedeutet das gemäss dem Gutachten der Universität Bern: mögliche Frakturen des Gesichtsschädels, Brustbeinbrüche und Leberrisse. Bis auf 60 Meter Schussdistanz können Rippenbrüche und irreversible Augenschädigungen mit «wahrscheinlichem Totalverlust» auftreten. Besonders gefährlich sind Herz- und Lungentreffer. Deshalb empfiehlt PTI Schweiz/KKPKS den Polizeien, nicht auf Kopf, Hals, Herz, Lunge, Leber oder das Rückgrat zu schiessen, sondern auf die Gürtellinie.
Dass Genitaltreffer auch schwere Verletzungen verursachen können, scheint PTI Schweiz/KKPKS schlicht vergessen zu haben. In einem Dokument zum Verletzungsrisiko von 40-Millimeter-Geschossen steht: «Bei festgelegtem Zielpunkt Gürtellinie» fänden sich «die höchsten Verletzungswahrscheinlichkeiten im Bereich des Scheitelpunktes der Flugbahn». Also bei ungewollt hohen Schüssen, die den Oberkörper treffen. Verletzungen im Genitalbereich werden nirgends erwähnt.
Elias Weber kann darüber nur den Kopf schütteln. «Ich wusste nicht, dass die Polizei genau dorthin zielt, wo ich verletzt wurde. Ich finde das erschütternd. Vor allem auch für den Nächsten, dem es einen Hoden zerreisst – oder noch mehr.»
Das Problem der ungenauen Grenzwerte
Weit häufiger als auf Wuchtgeschosse setzen Polizistinnen hierzulande auf Schrotmunition, mit der sie nur schlecht zielen können. «Das typische Krankheitsbild bei Treffern mit Gummigeschossen ist die Contusio bulbi, also das stumpfe Trauma des Augapfels», sagt Roman Eberhard, Leitender Arzt im Zürcher Triemlispital. Er hatte damals den schwer verletzten Claudio Massoni behandelt.
«Erfolgt diese Prellung mit viel Energie, können verschiedene Teile des Auges in Mitleidenschaft gezogen werden: Oft kommt es zu Schäden an der Linse und zur Ablösung der Netzhaut. Das muss meist operiert werden, sonst käme es unweigerlich zur Erblindung. Und auch mit einer Operation bleiben häufig irreversible Schäden, beispielsweise weil das Auge vernarbt.»
Wer eine starke Augenverletzung erleidet, muss für den Rest des Lebens in die Kontrolle, um Spätfolgen rechtzeitig zu erkennen. Sie können noch Jahre nach der Verletzung auftreten. Einäugige Menschen können vielen beruflichen und privaten Tätigkeiten nicht nachgehen, weil sie zu riskant sind. Claudio Massoni und Iwan S. beispielsweise mussten ihren Beruf als Handwerker und als Schreiner aufgeben. Auch Ballsportarten wären gefährlich. In seltenen Fällen kann zudem das Immunsystem falsch reagieren und das gesunde Auge angreifen.
Was immer bleibt: die Angst, das eine, gesunde Auge zu verlieren und ganz zu erblinden.
Um solche und andere schwere Verletzungen durch Gummigeschosse zu vermeiden, definieren die Sicherheitsbehörden Mindestdistanzen, die die Polizei einzuhalten hat, bevor sie schiesst. Für diese Mindestdistanzen beziehen sie neben eigenen Erwägungen auch Grenzwerte aus der ballistischen Fachliteratur ein, die zeigen, ab wann gewisse Verletzungen auftreten.
Ein Problem dieser Grenzwerte ist allerdings, dass die echte Welt viel Unschärfe mit sich bringt. Das gleiche Geschoss mit der gleichen Energie kann bei verschiedenen Menschen ganz unterschiedlich wirken.
«Bei der einen Personen entsteht eine starke Verletzung, bei der anderen ist kaum etwas sichtbar», sagt der Ballistiker und promovierte Forensiker Beat P. Kneubuehl, der ein wundballistisches Standardwerk mitverfasst hat und heute eine Beratungsfirma besitzt, die Schiessversuche mit Nachbildungen menschlichen Gewebes durchführt. Zu den Auftraggebern von Kneubuehls Beratungsunternehmen gehören auch Behörden wie PTI Schweiz oder die Kantonspolizei Bern.
Noch weiter geht Augenchirurg Roman Eberhard: «Die Grenzwerte beruhen auf sehr vagen Annahmen. Das sind Schätzungen mit extremer Bandbreite.» Je nachdem, wo ein Geschoss auftreffe, wie es geformt sei, in welchem Zustand das Auge zuvor war – das alles beeinflusse, wie schwer ein Auge verletzt wird. «Grenzwerte können das nicht ausreichend abbilden», sagt Eberhard.
Warum überhaupt Grenzwerte festlegen? «Es ist besser als nichts», sagt Beat Kneubuehl. «Wenn man Grenzwerte hat, kann man die Geschosse an etwas messen. Damit verhindert man wenigstens einen Teil der Verletzungen.» Bei bekannt gewordenen Verletzungen würde man die Grenzwerte zudem überprüfen und wenn nötig anpassen.
Es trifft bei weitem nicht nur Krawallanten
«Gummischrot». «Gummigeschoss». «Wuchtgeschoss». Die Begriffe vermitteln bei manchen das Bild von Krawallen, von einem wütenden Mob, der mit allen Mitteln gestoppt werden muss. Hier die Polizei, die für Ordnung sorgt. Dort die Randalierer, die alles kurz und klein schlagen.
Das alles kommt vor. Doch die Realität sieht oft anders aus. Immer wieder setzt die Polizei auch Gummigeschosse gegen friedliche Demonstrantinnen ein, gegen Unbeteiligte oder gegen Beobachter. Gummigeschosse werden in der Schweiz schnell und in grossem Ausmass eingesetzt – es geht um weit mehr als darum, eine «grössere Gruppe von Aggressoren» zu stoppen.
Vom Polizeieinsatz der «Basel nazifrei»-Demonstration im November 2018 existieren Videos, die die Polizei gefilmt hat und die der Republik vorliegen. Sie zeigen, wie Polizisten Gummischrot in eine Menschenmenge schiessen, die bis zu diesem Zeitpunkt völlig friedlich war. Und das nur, weil die Polizei mit dem Gummischrot die Demonstrantinnen ablenken wollte, wie polizeiinterne Aufnahmen belegen.
In den ersten 80 Sekunden eines Videos feuert die Polizei 43 Ladungen ab. Jede davon enthält 35 einzelne Geschosse. Das heisst: In weniger als anderthalb Minuten flogen 1505 Gummischrotteile in die Demonstration. Jedes dieser 1505 Einzelgeschosse hätte ins Auge gehen können.
In einem Fall geschah das auch: Es traf einen Demonstranten ins Auge und verletzte ihn schwer. Im Verfahren, das die Behörden wegen Landfriedensbruch gegen den Mann eröffnet hatten, brachte der Staatsanwalt ein altbekanntes Argument vor: Man wisse gar nicht, ob die Verletzung von einem Gummigeschoss stamme. Der Verletzte habe sich womöglich selbst eine Fahnenstange ins Auge geschlagen.
Auch andere Fälle belegen, dass die Polizei Gummigeschosse gegen Menschen einsetzt, die keineswegs gewalttätige Chaoten sind.
Mit erhobenen Armen ins Schrot
Nach einem Fussballmatch in Luzern im Januar dieses Jahres will eine Gruppe von Besuchern zu ihren Autos zurückkehren. Zwischen ihnen und den Fahrzeugen stehen zwei Polizeiketten. Als die erste Kette den Weg freigibt, läuft die Gruppe auf die zweite Polizeikette zu. Diese beginnt unvermittelt zu schiessen und verletzt einen der Besucher schwer im Auge.
Ein Video des gleichen Abends zeigt eine Person, die mit erhobenen Armen auf eine Polizeikette zugeht. Statt Pfefferspray oder ein anderes milderes Mittel einzusetzen, schiesst ein Polizist aus wenigen Metern Entfernung eine Ladung Gummischrot auf den Mann.
Ein anderes Video aus Bern zeigt, wie die Berner Kantonspolizei bei der Schützenmatte einen Mann festnimmt. Verschiedene Personen beobachten die Szene. Als die Beamten Verstärkung erhalten, kommt eine Polizistin mit Gummischrotgewehr hinzu. Einer der Beobachter filmt und nimmt die Frau ins Bild. Die Polizistin reagiert, indem sie das Gewehr hebt und ihm aus etwa einem Meter Distanz auf den Kopf zielt.
Bei einer ähnlichen Situation im Berner Stadtteil Bethlehem trennt ein Polizist in Zivil eine Schlägerei. Dabei zielt er mit einem Mehrzweckwerfer mehrmals gegen zwei am Boden liegende Jugendliche, aus circa einem Meter Abstand. Das Gewehr ist auf die Köpfe und die Oberkörper gerichtet.
Ob der Polizist Gummischrot oder ein Wuchtgeschoss geladen hatte, lässt sich aus dem Video nicht beurteilen. Beide Munitionstypen können aus dieser Distanz einen Menschen schwer verletzen, Wuchtgeschosse können lebensgefährlich sein, wenn sie die Herz- und Lungenregion treffen. Bei einer minimalen Schussdistanz von 5 Metern, wie sie PTI Schweiz/KKPKS empfiehlt, liegt die Wahrscheinlichkeit für lebensgefährliche Verletzungen bei 2 bis 9 Prozent.
Das heisst im besten Fall: Jeder fünfzigste Mensch, dem die Polizei aus 5 Metern Entfernung mit einem Wuchtgeschoss in die Herz- oder Lungenregion schiesst, könnte sterben. Im schlechtesten Fall jede elfte.
Doch auch wenn die Situation nicht im schlimmstmöglichen Szenario endet, können die Folgen massiv sein, wie die Geschichte von Angela D. zeigt.
«Sie schossen in eine dicht gedrängte Menge»Angela D.
Angela D. war 19 Jahre alt und zuvor noch nie an einer Kundgebung gewesen, als sie im September 2013 auf den Strassen Winterthurs tanzte, zusammen mit ein paar hundert anderen. Die Veranstaltung hiess «Standortfucktor» und fand ohne Bewilligung statt. Die Teilnehmerinnen trafen sich vor dem Hauptbahnhof, es gab Musik, Tanz – und ein riesiges Polizeiaufgebot.
«Wir konnten fast nirgends hin, die Polizei riegelte den Zugang zur Altstadt und zu den grossen Verkehrsachsen ab», erzählt Angela D. «Also bewegten wir uns in Richtung Salzhaus, das war der einzige offene Weg.» Ja, es habe vermummte Krawallmacher gegeben, die Pyros und andere Gegenstände gegen die Polizei warfen. Aber das seien nur wenige gewesen, sagt sie. «Alle anderen wollten tanzen. Zuerst fuhren die Wasserwerfer auf. Dann schossen sie mit Gummischrot in eine dicht gedrängt stehende Menge, die sich nicht fortbewegen konnte. Das darf man doch nicht!»
Der Studentin war die Situation unheimlich geworden, sie suchte nach einem Versteck, wollte im Hohlraum unter einer Passerelle warten, bis sich die Lage beruhigte. Sie schaffte es nicht dorthin.
Sie stand allein zwischen zwei parkierten Autos, als sie einen heftigen Schlag im Gesicht spürte. Schreiend brach sie zu Boden. Sie blutete aus dem rechten Auge. Freunde brachten sie ins Kantonsspital. Und seit dieser Nacht sieht sie mit dem verletzten Auge nur noch zwischen 5 und 20 Prozent.
Angela D. erstattete Strafanzeige. Doch zu einem Prozess gegen die Polizei kam es nie.
Die Staatsanwaltschaft stellte die Untersuchung ein erstes Mal ein und wurde vom Zürcher Obergericht dazu verdonnert, der Sache nachzugehen. Die zweite Untersuchung eines anderen Staatsanwalts fiel deutlich umfassender aus als die erste. Aber auch der zweite Staatsanwalt entschied, keine Anklage zu erheben: Es sei nicht erwiesen, dass die Studentin von Gummischrot getroffen worden sei. Es seien keine Polizisten in der Nähe gestanden. Die Augenverletzung könne auch von einem Ellenbogen- oder Stockstoss stammen.
Dafür folgte eine Gegenanzeige: Angela D. wurde vorgeworfen, an einer unbewilligten Kundgebung teilgenommen zu haben. Dafür wurde sie mit 1100 Franken Busse bestraft.
Neun Jahre nach der Winterthurer Tanzkundgebung «Standortfucktor» steht Angela D. wieder am Ort des Geschehens. Sie erinnert sich: Dort standen die Wasserwerfer, hier die eingekesselten Menschen. Und da war das Versteck, in das sie sich verkriechen wollte. Die junge Frau sagt, vielleicht schon zum hundertsten Mal, es sei niemand in ihrer Nähe gewesen, als sie am Auge getroffen worden sei: «Die nächsten Menschen standen mindestens drei Meter von mir entfernt.»
Es gebe keine andere Erklärung für ihre schwere Augenverletzung als Gummischrot. Und es sei ja anerkannterweise zum Gummischroteinsatz gekommen.
Trotzdem hätten ihr die Behörden nicht geglaubt. Und zu einem Augenschein vor Ort sei es auch nie gekommen. Das habe die Strafverfolger nicht interessiert.
«Ich habe die zweite Einstellung stillschweigend angenommen, da mein Anwalt keine Erfolgschancen bei einem Weiterzug sah. Während der ganzen Untersuchung hatte ich den Eindruck, dass ich die Schuldige bin – nicht die angezeigte Polizei.»
Kaum Chancen bei einer Strafanzeige
Was Angela D. erlebt hat, die Gegenanzeige und vor allem die zweimalige Einstellung des Verfahrens, ist ein wichtiger Grund, dass sich Claudio Massoni für eine Staatshaftungsklage entschieden hat. Sein Anwalt Philip Stolkin betont, er habe «nicht eine Nanosekunde lang daran geglaubt», in einem Strafverfahren eine Chance zu haben. «Es gibt keine Verurteilungen von Polizisten, ich kenne keine einzige. Darum haben wir uns für den zivilrechtlichen Weg entschieden. Da müssen wir zwar sämtliche Beweise auf den Tisch legen, statt dass es eine Untersuchung durch die Behörde gibt. Aber wir haben dennoch die grösseren Chancen.»
Auch David Böhner, der Berner Aktivist und AL-Stadtparlamentarier, hat auf dem strafrechtlichen Weg nichts erreicht. Irgendwann gab er auf. Keine Nerven mehr, keine Zeit, kein Geld. Nach dem zweiten Freispruch des schiessenden Polizisten liess er die Sache bleiben.
Dabei sah die Sache aussichtsreich aus.
Denn es gab diverse Videoaufnahmen, die zweifelsfrei zeigten, wer die Gummischrotsalve abgegeben hatte, die Böhner ein Auge kostete. Eine ungewöhnlich komfortable Beweissituation in einem Strafverfahren. Könnte man meinen.
Der Aktivist zeigte den Schützen an. Doch die erstinstanzliche Richterin sprach den Polizisten vom Vorwurf der schweren Körperverletzung frei. Sie hatte sich geweigert, das Videomaterial zu sichten – um dann zu entscheiden, es sei nicht «rechtsgenügend» erwiesen, wer geschossen habe.
David Böhner zog den Freispruch weiter. Die zweitinstanzlichen Richterinnen am Obergericht sahen sich sämtliche Beweismittel an. Und kamen ebenfalls zu einem Freispruch, in dubio pro reo – im Zweifel für den Angeklagten: Der schiessende Polizist sei zwar identifiziert worden. Er habe aber rechtmässig und verhältnismässig gehandelt.
Böhner unterlag zum zweiten Mal vor Gericht. Und bekam auch noch die Anwaltskosten des freigesprochenen Polizisten aufgebrummt.
Auch früher wurden schon Gummigeschosse mit schwerwiegenden Folgen eingesetzt, allerdings herrschte bei der juristischen Aufarbeitung offenbar mehr Kulanz, wie Egon Fässler berichtet.
«Ich bin keine bedauerliche Ausnahme»Egon Fässler
«Ich fürchte mich. Immer noch werden Gummigeschosse eingesetzt. Ich bin nicht der Einzige, der ein Auge verloren hat. Ich bin keine bedauerliche Ausnahme. Früher war das Augenlicht für mich etwas Selbstverständliches. Heute, angewiesen auf das mir verbleibende gesunde Auge, bin ich mir bewusst geworden, welch eine kostbare Gabe das Augenlicht ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich ganz erblinde, ist grösser geworden und begleitet mich ein ganzes Leben.»
Das ist ein Ausschnitt eines langen Briefs an den Zürcher Stadtrat. Er datiert vom 2. Februar 1982.
Der Absender heisst Egon Fässler, heute 68 Jahre alt. Und er weiss noch heute haargenau, was ihn vor 40 Jahren dazu brachte, diese Zeilen zu schreiben.
September 1981 war die Zeit der Zürcher Jugendunruhen, es gab Demonstrationen, Spektakel, Proteste und Krawalle in den Strassen – und erstmals nutzte die Zürcher Polizei ein neues Einsatzmittel: Gummischrot. Fässler war auf dem Heimweg, er stand auf der Bahnhofbrücke in Zürich, zwischen Hauptbahnhof und Central. Er musste weiter in Richtung See, aber auf dem Weg dorthin lieferten sich Demonstrierende und die Polizei Scharmützel.
«Ich stand also am Brückengeländer und überlegte, was ich tun sollte. Neben mir waren ein paar Kids und andere Passanten, es war ruhig, das Demogeschehen spielte sich woanders ab. Da fuhr ein offener Einsatzwagen an uns vorbei. Polizisten in Vollmontur sassen drin. Ich machte den Fehler, dass ich dem Wagen nachschaute. Dann knallte es, und ich spürte einen Schmerz im linken Auge. Als ich es zu öffnen versuchte, lief eine schwarze Suppe runter.»
Heute hat Fässler auf dem verletzten Auge noch eine Sehkraft von etwa drei Prozent. In seinem Brief an die Zürcher Exekutive beschreibt er die psychischen Folgen der schweren Verletzung: Er leide unter Angstzuständen und Depressionen. «Ich kann immer noch nicht begreifen, dass Sie mit solch gefährlichen Mitteln für Ordnung sorgen lassen. Ich kann es mir nur dadurch erklären, dass Sie sich der Gefährlichkeit nicht voll bewusst sind.»
Egon Fässler begnügte sich nicht mit Warnungen und Aufrufen. Er erhob Staatshaftungsklage gegen die Stadt Zürich. Das Gleiche tun heute Claudio Massoni und sein Anwalt Philip Stolkin – allerdings nicht gegen die Stadt, sondern gegen den Kanton Zürich.
Fässler liess sich damals von Rechtsanwalt Moritz Leuenberger vertreten, dem späteren SP-Bundesrat. Seine Staatshaftungsklage endete im Mai 1983 mit einem Vergleich: Die Stadt Zürich bezahlte dem Verletzten 130’000 Franken, per saldo aller Ansprüche «aus diesem Ereignis».
Er sei mit diesem Ergebnis zufrieden gewesen, sagt Fässler. Die Stadt habe rasch eingelenkt. Man habe nicht lange verhandeln müssen.
Breite Bewegung gegen Gummigeschosse
In den turbulenten 1980er-Jahren war in breiten Teilen der Bevölkerung und der Politik das Entsetzen über das neue polizeiliche Einsatzmittel gross, das so viel Schaden anrichtete. Eltern und Ärztinnen organisierten sich, sammelten Informationen über die Schwerverletzten, forderten ein sofortiges Verbot von Gummigeschossen. Politische Anfragen und Vorstösse wurden eingereicht.
Kulturschaffende und Intellektuelle meldeten sich zu Wort: Wer Gummigeschosse toleriere, demonstriere eine «Bereitschaft zum Bürgerkrieg» und sei deshalb der «nicht zu tolerierende Aggressor im Staat», schrieb etwa der Philosoph und Publizist Hans Saner.
1981 beschloss die deutsche Innenministerkonferenz, sich gegen die Verwendung von Gummigeschossen auszusprechen. Sie stufte die Munition aufgrund der ausländischen Erfahrung als zu gefährlich ein.
1982 empfahl das Europäische Parlament seinen Mitgliedstaaten, Plastikgeschosse zu verbieten – und erwähnt explizit zwei Zürcher Jugendliche, die bei einem Gummischroteinsatz ein Auge verloren. 1997 wiederholte es die Empfehlung.
2012 sprach sich die deutsche Gewerkschaft der Polizei (GdP) gegen eine Aufrüstung der Polizei mit Gummigeschossen aus. «Wir leben in Deutschland nicht in einem Bürgerkrieg.» Wer Gummigeschosse einsetzen wolle, nehme bewusst in Kauf, «dass es zu Toten und Schwerverletzten kommt. Das ist in einer Demokratie nicht hinnehmbar.» Gummigeschosse kommen heute in zwei Bundesländern zum Einsatz: Hessen und Sachsen. In Hessen dürfen allerdings nur Spezialkommandos Gummigeschosse einsetzen.
In der Schweiz hingegen werden immer neue Varianten von Gummigeschossen eingeführt. Und eingesetzt. Und zwar häufig. Wer sie verbieten lassen will, beisst hierzulande auf Granit.
Aber wäre ein Verbot überhaupt nützlich? Zu dieser Frage äussert sich zum Abschluss Martin Lauber.
«Es wird weiter Verletzte geben»Martin Lauber
«Ob ich gegen Gummigeschosse bin, wollt ihr wissen. Ernsthaft?»
Martin Lauber ist sichtlich irritiert. Er war 23 Jahre alt, als er 1996 in Zürich an einer unbewilligten und unfriedlichen 1.-Mai-Nachdemonstration teilnahm – an vorderster Front. Als die Polizei mit Gummischrot auf die schwarz gekleidete Truppe schoss, traf sie ihn im Gesicht. Blut floss in Strömen, er verlor zwei Zähne. Bis heute hat Lauber mit Komplikationen zu kämpfen. Unter anderem kam es zu schweren Entzündungen, die den Kieferknochen beschädigten. Als wir mit ihm ein Treffen vereinbaren wollen, muss er uns um eine Woche vertrösten: Zahnarzttermin. Immer noch wegen dieses Gummischrots vor 26 Jahren.
«Kraftvoll zubeissen», sagt Lauber, «diese Zeiten sind seit 1996 vorbei.»
Und trotzdem zögert er, was die Forderung nach einem Verbot von Gummigeschossen betrifft. Nicht weil er sie gut findet, aber weil er sich fragt, ob ein Verbot etwas nütze. Denn letztlich sei es egal, welches Mittel die Polizei einsetzt, wenn sie es nicht vorschriftsgemäss tut. Die bewaffneten Polizisten in Vollmontur, die vor ihm und den anderen standen, seien nur wenige Meter entfernt gewesen, als sie abgedrückt hätten. Darum auch die schlimme Verletzung im Gesicht.
«Ich habe keine Anzeige erstattet. Ich weiss, ich hätte es tun sollen. Doch die Polizei kommt immer straffrei davon. Niemand kann sich so viel erlauben wie sie. Es wird weiter Verletzte geben.»
Die Namen der verletzten Opfer von Gummigeschossen wurden geändert oder abgekürzt – mit Ausnahme von David Böhner und Egon Fässler. Zur Transparenz: Egon Fässler gehört seit Ende Oktober dem Sprecherteam der Republik an.