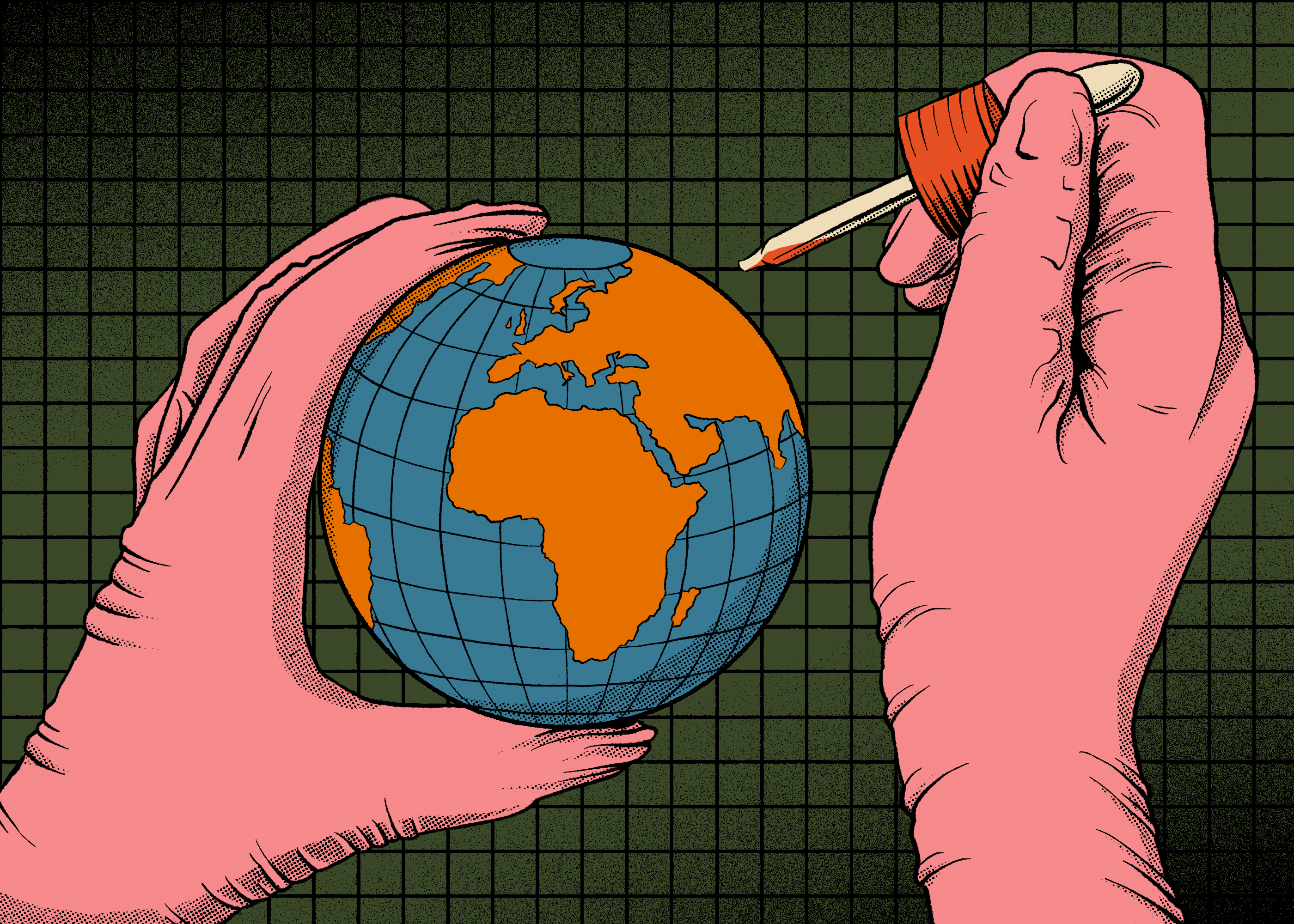
Stille Pandemie: Wie antibiotikaresistente Bakterien die Menschheit bedrohen
Weltweit sterben immer mehr Menschen, weil Antibiotika nicht mehr wirken. Pharmafirmen haben die Entwicklung neuer Wirkstoffe aufgegeben, obwohl es vielversprechende Forschung gibt. Wie geht es jetzt weiter?
Von Cornelia Eisenach (Text) und Philipp Beck (Illustration), 19.04.2024
Journalismus, der Ihnen hilft, Entscheidungen zu treffen. Und der das Gemeinsame stärkt: die Freiheit, den Rechtsstaat, die Demokratie. Lernen Sie uns jetzt 21 Tage lang kostenlos und unverbindlich kennen:
Vier Mäuse waren tot. Der Chemiker Ernst Boris Chain war ausser sich vor Begeisterung. Aber nicht wegen der toten Tiere.
Es war Sonntagmorgen, der 26. Mai 1940. Am Tag zuvor hatten die Mäuse eine tödliche Spritze erhalten: Bakterien direkt ins Blut.
Vier weiteren Mäusen hatten Chain und seine Kollegen zusätzlich eine Substanz verabreicht, die später als «Wunderdroge» bezeichnet werden sollte: Penizillin. Diese Mäuse überlebten. Es war der Beginn einer neuen Zeitrechnung in der Medizin.
Heute, keine hundert Jahre später, droht uns das Ende dieser Ära: Antibiotika wirken nicht mehr, weil die Bakterien gelernt haben, sich gegen sie zu wehren.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zählt Antimikrobielle Resistenz (AMR) inzwischen zu den grössten Gefahren für die globale Gesundheit. Neben dem Klimawandel und nicht übertragbaren Krankheiten.
Antibiotikaresistenzen sind so etwas wie eine stille Pandemie: eine globale Bedrohung, von der wir wenig hören und kaum etwas merken.
Wir sehen nicht die Menschen, die Lungenentzündungen erliegen, weil Antibiotika nicht mehr wirken. Schätzungsweise 1,3 Millionen Menschen weltweit starben allein im Jahr 2019 an dieser und anderen Infektionskrankheiten – eine Zahl, die die Todesfälle durch Malaria oder Aids übertrifft. Etwa jedes fünfte Opfer war ein Kind unter fünf Jahren. Betroffen sind vor allem Menschen in Subsahara-Afrika und Südasien.
2050 könnten weltweit 10 Millionen Menschen sterben, sagt eine Prognose. Auch wenn einige Experten die Zahl für übertrieben halten: Resistenzen nehmen zu und Resistenzen breiten sich aus. Neue Antibiotika gibt es kaum.
Das Problem ist seit Jahrzehnten bekannt, doch erst seit etwa zehn Jahren arbeitet man ernsthaft an einer Lösung. 2016 trafen sich die Staatsoberhäupter der Vereinten Nationen zum ersten Mal überhaupt zu einem «High-Level-Meeting» zum Thema Antimikrobielle Resistenz. Seit 2015 haben sich die WHO, die G-20 und die Weltbank dem Problem gewidmet, und viele Nationalstaaten haben Strategien und Aktionspläne verabschiedet. Auch die Schweiz veröffentlichte 2015 eine «Strategie Antibiotikaresistenzen».
Solche Strategien fokussieren meist auf drei Punkte: Länder müssen die Verbreitung von Resistenzen besser überwachen, den Antibiotika-Übergebrauch verhindern und in die Erforschung neuer Wirkstoffe investieren.
Neue Wirkstoffe könnte die Pharmaindustrie entwickeln. Doch die baut ab.
Zwischen 2016 und 2018 stellten die vier Pharmariesen Astra Zeneca, Sanofi, Novartis und Allergan ihre Suche nach neuen Antibiotika ein. 2015 schloss die Firma Merck ihr Forschungslabor, das auf neue Antibiotika spezialisiert war, und setzte damit einen Trend fort, der bereits in den 1970er-Jahren begonnen hatte: Die Pharmafirmen bringen immer weniger neue Antibiotika auf den Markt. Denn sie halten das Geschäft für uninteressant: Sie investieren in ein Medikament, das so wenig wie möglich zum Einsatz kommen soll. Chronische Krankheiten sind lukrativer. Im Jahr 2021 waren weltweit 6000 Krebsmedikamente in Entwicklung, aber nur 30 Antibiotika.
Dabei brachten Antibiotika den Pharmafirmen einst schwindelerregende Profite: Medikamente, die 14 Cent in der Herstellung kosteten, konnte man für 15 Dollar verkaufen. Ohne Antibiotika gäbe es heute nicht die Pharmaindustrie, wie wir sie kennen.
1. Kostbarer Urin
Pharmafirmen sind notwendig, damit eine Entdeckung den Weg vom Labor auf den Markt findet. Zu dieser Erkenntnis kam Ernst Boris Chain bereits 1940. Er arbeitete daran, das Penizillin sauber und konzentriert aus dem Penizillin-Pilz, einem blau-grünen Schimmel, zu gewinnen.
Aber der Wirkstoff war «unstabil wie ein Opernsänger», die Mengen waren winzig. An der Aufgabe war bereits Alexander Fleming gescheitert.
Dieser hatte das Penizillin zufällig entdeckt, als er im Sommer 1928 eine Bakterienkultur offen im Labor stehen liess. Nach seiner Rückkehr aus den Ferien bemerkte er, dass sich ein Schimmelpilz breitgemacht und die Bakterien abgetötet hatte. Er spekulierte, Penizillin könnte gegen bakterielle Infektionskrankheiten helfen.
Doch Fleming tat sich schwer, das Penizillin in Reinform zu gewinnen. Er gab es bald auf. «Der Aufwand für die Herstellung erschien nicht lohnenswert», schrieb er später. Zehn Jahre lang geschah nichts. Das erste Antibiotikum der modernen Medizin wäre beinahe eine Kuriosität aus dem Labor geblieben.
Ernst Chain und seinen Kollegen gelang es dann, das Penizillin zu stabilisieren. Aber: Sie brauchten mehr davon.
Als die Forscher ihren ersten Patienten behandelten, einen Polizisten, der sich bei der Gartenarbeit an einem Rosendorn verletzt und infiziert hatte und nun im Sterben lag, ging ihnen das Penizillin aus. Sie wussten aber, dass der Urin des Patienten überschüssiges Medikament enthielt. Also fuhr jeden Morgen ein Mitglied des Forscherteams mit dem Velo vom Labor an der englischen Universität Oxford ins nahe gelegene Spital, um den Urin des Patienten abzuholen und daraus im Labor mehr Wirkstoff zu gewinnen.
Das Penizillin reichte trotzdem nicht, um den Patienten zu heilen. Er starb.
Chain und seinen Forschungskollegen war klar: Sie brauchten professionelle Hilfe. Sie brauchten industrielle Anlagen, die ihnen das Zeug hektoliterweise liefern konnten. Doch als die Wissenschaftler bei den Pharmafirmen Grossbritanniens anfragten, bekamen sie nur Absagen.
Sie reisten in die USA. Hier liessen sich die Arzneimittelhersteller überzeugen. Auch, weil der Staat eingriff.
Die US-amerikanische Behörde für wissenschaftliche Forschung und Entwicklung OSRD, die Forschung zu militärischen Zwecken koordinierte, nahm sich der Sache an. Denn Soldaten starben nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern auch an den Infektionen ihrer Kriegswunden.
«Für das Militär war Penizillin von zentraler Bedeutung», sagt der Medizinhistoriker Flurin Condrau von der Universität Zürich, der sich mit der Geschichte von Antibiotikaresistenzen beschäftigt. «Die Armee sorgte dafür, dass Penizillin sehr schnell hergestellt werden konnte.» Das OSRD initiierte das «penicillin project».
Die Pharmafirmen, die sich daran beteiligten, erhielten Abnahmegarantien und Steuervergünstigungen. Die Konditionen waren so gut, dass Merck und Pfizer ihre Investitionen innerhalb von fünf Jahren amortisierten. Später verkaufte der Staat mit öffentlichen Geldern gebaute Produktionsanlagen zum Spottpreis.
2. Das goldene Zeitalter
Dass die Pharmafirmen zu Riesen wuchsen, verdankten sie neben dem Militär und dem Penizillin-Pilz einem Bakterium, dessen antibiotische Eigenschaften kurze Zeit später entdeckt wurden. Es hiess: «der Goldmacher». Es sah nicht nur aus wie Gold, sondern war auch genauso einträglich.
Denn der Wirkstoff daraus war gegen verschiedene Arten von Bakterien wirksam. Es war das erste Breitband-Antibiotikum. Mit ihm machten Pharmafirmen Profite zwischen 35 und 50 Prozent. Bei Penizillin lag die Profitmarge «nur» bei 5 Prozent.
Der Begründer dieses Erfolgs war Selman Waksman. Er suchte systematisch nach neuen Wirkstoffen für Antibiotika. Dafür sammelte er Bodenproben und testete Hunderttausende Mikroben auf antibakterielle Eigenschaften. 1943 entdeckte er Streptomyzin, eines der erfolgreichsten Antibiotika überhaupt. Es erlaubte die Behandlung von Tuberkulose, einer Krankheit, gegen die Penizillin machtlos gewesen war.
«Ab ungefähr 1945 war der Industrie weltweit klar: Wer jetzt Geld verdienen will, der geht in Antibiotika», sagt Medizinhistoriker Condrau. Ein Jahrzehnt lang herrschte Goldgräberstimmung.
Dann kam die Grippepandemie von 1957. «Sie war ein Schlüsselmoment», sagt Condrau. Weltweit starben ein bis zwei Millionen Menschen. Ein Grossteil fiel aber nicht der Grippe zum Opfer, sondern sogenannten Sekundärinfektionen, insbesondere Lungenentzündungen. Diese liessen sich nicht mehr mit den verfügbaren Antibiotika behandeln. Das Bakterium, das die Krankheiten auslöste, war resistent geworden.
«Das führte zu einer Krise im medizinischen Denken», sagt Condrau. Man hatte sich daran gewöhnt, dass man Infektionen mit Antibiotika behandelt, ältere Behandlungsmethoden gerieten in Vergessenheit.
Die Krise verschärfte sich mit dem Auftauchen von MRSA, einem Keim, der gegen das halbsynthetische Antibiotikum Methizillin resistent war. «Mitte der 1960er-Jahre war klar, dass Antibiotikaeinsatz zwingend zu Resistenzen führt», sagt Condrau. «Das bedeutete für die Pharmafirmen: Ausstieg aus dem Geschäft.» In den 1960er-Jahren kamen die letzten Antibiotika auf den Markt, die gegen eine der zwei grossen Bakteriengruppen, die Gramnegativen, wirkten.
3. Tiermast
Resistente Bakterien entstanden im Wesentlichen aus zwei Gründen. Erstens: weil Ärzte hemmungslos Antibiotika verschrieben, ohne genau zu wissen, was wogegen wirkte. Das war eine Folge der damals noch unregulierten Werbeversprechen der Pharmafirmen, die unablässig Anzeigen für ihre Präparate in medizinischen Fachjournalen schalteten. Zweitens: weil Antibiotika zunehmend auch in der Landwirtschaft zum Einsatz kamen.
In den 1940er-Jahren war es üblich, das Futter von Nutztieren mit Vitaminen anzureichern. Besonders Vitamin B12 war ein wichtiger Zusatz. Zufällig entdeckte man, dass Vitamin B12 auch bei der Produktion eines Antibiotikums entstand, und verfütterte es an junge Schweine. Deren Wachstum verdreifachte sich daraufhin.
Von da an begannen die Pharmafirmen Antibiotika auch als Wachstumsförderer an Bauern zu verkaufen. Nutztiere entwickelten mehr Muskelmasse und wuchsen schneller. Bei Hühnchen betrug die Gewichtszunahme bis zu 15 Prozent. Im Jahr 1966 enthielten 80 Prozent des Futters für junge Schweine, Kälber und Geflügel in Westdeutschland Antibiotika.
Erst diese Praxis ermöglichte die industrielle Massentierhaltung. Auf engem Raum bei schlechter Hygiene stieg das Infektionsrisiko, das man mittels Antibiotika kontrollierte. Kälbern, die in den 1960er-Jahren in Massen auf den Markt transportiert wurden, hängten Bauern kleine Beutel mit Penizillin um den Hals. Denn es war klar, dass dort Krankheiten entstehen und sich ausbreiten würden.
In der Folge stieg der globale Fleischkonsum drastisch, er wuchs stärker als die Weltbevölkerung. Im Jahr 1961 verzehrte eine Person im weltweiten Durchschnitt 24 Kilogramm pro Jahr. Im Jahr 2014 waren es 43 Kilogramm.
Dieser grenzenlose Fleischhunger hat nicht nur den Klimawandel, den Verlust der Artenvielfalt, die Verschmutzung der Gewässer beschleunigt. Sondern auch die tödlichsten Bakterien hervorgebracht, die sich je auf unserem Planeten tummelten.
In Millionen von Tiermägen trafen Darmbakterien auf Antibiotika. Und zwar in einer Dosis, die die Bakterien nicht tötete, sondern sie anregte, ihr chemisches Waffenarsenal zu aktivieren oder anzupassen. Wann immer Expertinnen auf diese Gefahr hinwiesen, hielten Akteure aus der Agrarindustrie dagegen: Die Resistenzen beträfen nur die Tiere, für die Gesundheit von Menschen sei das kein Problem.
Dabei hatten japanische Forscher schon Ende der 1950er-Jahre herausgefunden, dass Bakterien Erbgut untereinander austauschen können und dass Resistenzen nicht bei den Tieren bleiben.
Heute herrscht Einigkeit, dass der Antibiotikagebrauch in der Tiermast auch den Menschen gefährden kann. Allerdings ist umstritten, wie direkt die Verbindung zwischen Resistenzen bei Tier und Mensch ist.
Sicher ist: Es gehört zum Wesen eines Bakteriums, sich zu wehren, wenn es angegriffen wird, also Resistenzen zu entwickeln. Grundsätzlich hat ein Bakterium dazu zwei Möglichkeiten: Entweder sein Erbgut verändert sich so, dass eine Schwachstelle mutiert und Antibiotika sie nicht mehr angreifen können. Es bildet sich sozusagen einen biologischen Panzer.
Oder das Bakterium stellt chemische Waffen her, zum Beispiel Eiweisse, die ein Antibiotikum einfach zerstückeln. Die Bauanleitungen für diese chemischen Waffen liegen in einer Art Munitionslager ausserhalb des regulären Erbguts der Bakterien. Es sind sogenannte Resistenzgene, die die Bakterien untereinander austauschen können. So sammeln die Bakterien viele verschiedene Bauanleitungen, Resistenzen gegen viele verschiedene Antibiotika. Sie werden zu multiresistenten Keimen, zu sogenannten Superbugs.
Gegen multiresistente Keime gab es bis vor kurzem noch eine letzte Hoffnung. Das sogenannte Reserveantibiotikum Colistin. Da es die Nerven und Nieren schwer schädigt, nutzen es Mediziner nur im Notfall.
Doch 2015 entdeckte man auf einer Schweinefarm in China Bakterien, die gegen dieses Reserveantibiotikum resistent geworden waren. Mehr noch, man fand die Resistenzen später auch bei menschlichen Patienten. Da Ärzte es in der Humanmedizin kaum anwenden, gehen Forscher davon aus, dass sie den Weg in den Menschen über die Tiermast gefunden haben müssen.
4. Kräftemessen
Bereits Ende der 1960er-Jahre versuchten einige Länder, Antibiotika im Tierfutter zu verbieten. In Grossbritannien durften die Landwirtschaftsbetriebe gewisse Antibiotika nicht mehr als Wachstumsförderer nutzen. Allerdings hatte das nur einen geringen Effekt. Denn nun verschrieben Tierärzte die Antibiotika im Übermass aus therapeutischen Gründen.
In der Schweiz trat 1973 eine ähnliche Verordnung in Kraft. Doch auch hier ging der Antibiotikaeinsatz nicht merklich zurück. Entweder weil sich Betriebe nicht an ein Verbot hielten, oder weil Tierärzte einfach mehr verschrieben.
In den USA schlugen sämtliche Regulierungsversuche fehl. Die Bedenken der Agrarindustrie über die wirtschaftlichen Auswirkungen eines Verbots überwogen jene der Lebens- und Arzneimittelbehörde.
Der Versuch, Antibiotika in der Tiermast in den Griff zu bekommen, sei eine Geschichte des Versagens, schreibt der Medizinhistoriker Claas Kirchhelle. Aber sie enthalte wichtige Lektionen für die Gegenwart. Eine der wichtigsten: «dass nationale Vorschriften nur begrenzte Wirksamkeit haben».
Zwar gab es in den 1960er-Jahren Bemühungen, das Resistenzproblem international anzugehen, doch sie scheiterten. Die WHO habe damals versucht, eine global funktionierende Kommission für Antibiotika-Sensitivität zu gründen, sagt Medizinhistoriker Flurin Condrau. Sie sollte sich mit Praktiken gegen die Ausbreitung von Resistenzen beschäftigen. «Doch das wurde von Ländern mit grosser Pharmaindustrie ausgebootet», sagt Condrau. «Das führte dazu, dass die WHO diese Anstrengungen einstellte.»
In der EU sind erst seit 2006 sämtliche Antibiotika zur Wachstumsförderung in der Tiermast verboten. In der Schweiz ist das seit 1999 der Fall. Doch ausserhalb Europas gibt es solche Verbote kaum oder nur Selbstverpflichtungen der Agrarproduzenten.
Weltweit ist der Antibiotikaverbrauch in der Landwirtschaft höher als in der Humanmedizin. Und er wird weiter steigen, wie eine Studie von Gesundheitswissenschaftlern der ETH Zürich zeigt. Demnach könnten im Jahr 2030 rund 8 Prozent mehr Antibiotika verabreicht werden als 2020. Spitzenreiter sind China, Brasilien, Indien, die USA und Australien.
Doch auch hierzulande ist nicht alles im Lot: In der Schweiz erhielten Milchkühe im Jahr 2017 mehr Antibiotika als in irgendeinem anderen Land Europas. Euterentzündungen sind ein Hauptgrund dafür. Hochleistungskühe sind so gezüchtet, dass sich ihre Euter schnell leeren lassen, wodurch aber auch Bakterien leichter eindringen können.
5. Blinde Passagiere
Resistente Keime entstehen in der Tiermast, oft in fernen Ländern. Aber wenn es um ihre Verbreitung geht, sind sie uns näher, als uns lieb sein mag. Sie reisen oft als blinde Passagiere in unserem Darm aus dem Urlaub mit zurück nach Hause.
2015 untersuchte ein internationales Team von Forscherinnen, unter ihnen die Infektiologin Esther Künzli, Stuhlproben von Laos-Reisenden aus Europa. 70 Prozent von ihnen brachten aus dem südostasiatischen Land Bakterien mit, die gegen die Antibiotika-Klasse der Zephalosporine resistent waren.
Eine weitere Studie untersuchte Reisende, die sich auf der ostafrikanischen Insel Sansibar aufgehalten hatten. Ein Drittel von ihnen hatte nach der Rückkehr multiresistente Bakterien im Darm, die jenen der Inseleinwohner glichen.
Und niederländische Touristen brachten insgesamt 56 unterschiedliche Antibiotikaresistenzgene mit von ihren Auslandsaufenthalten. Die Muster der Resistenzen im Darm der Rückkehrer gaben sogar Aufschluss über ihren Ferienort. Forscherinnen konnten bestimmen, ob die Reisenden in Nordafrika, Südafrika, Pakistan, Indien, Bangladesh oder Südostasien gewesen waren.
«Antibiotikaresistente Bakterien reisen», sagt Esther Künzli, die am Swiss Tropical and Public Health Institute die Ausbreitungswege von Resistenzen erforscht. «Wenn sie irgendwo entstehen, wird sie irgendjemand mitnehmen.»
Wieder daheim können die «Souvenirs» ihre Resistenzgene an andere Bakterien im Darm oder in der Umwelt weitergeben. Bei schlechter Händehygiene beispielsweise ist es möglich, dass sie es sich auch bei Familienmitgliedern bequem machen. «Auch wenn resistente Keime bei gesunden Personen keine Symptome verursachen müssen – verbreitet haben sie sich trotzdem», sagt Künzli.
Höchstwahrscheinlich infizieren sich Urlauber vor Ort über kontaminierte Lebensmittel. Die Resistenzen der Sansibar-Rückkehrer glichen zum Beispiel denen der Keime auf Hühnerfleisch. Zudem können resistente Bakterien über schmutziges Wasser und Gülle aus der Tierzucht aufs Feld gelangen, auf Salat und Gemüse.
Das kann auch in der Schweiz passieren. Wenn bei Starkregen die Auffangbecken der Kläranlagen überlaufen, gelangt schmutziges Wasser in Flüsse und Seen und von dort auf die Felder. Schweizer Forschende fanden auch im Abwasser der Stadt Basel schon Resistenzgene.
Wissenschaftler reden von Reservoiren an Resistenzgenen, die sich im Boden, in Gewässern, im tierischen und menschlichen Darm bilden. Um das Problem in den Griff zu bekommen, brauche es einen sogenannten One-health-Approach, sagt Esther Künzli. Also Massnahmen, die die Gesundheit von Tieren, Menschen und Umwelt zusammendenken.
Infektionen mit resistenten Bakterien erfolgen auch in Spitälern. Besonders wahrscheinlich sei das bei Spitalaufenthalten in Südeuropa, sagt Stephan Harbarth, Leiter der Abteilung für Infektionsprävention und -kontrolle an den Genfer Universitätsspitälern. «Wer in Italien oder Griechenland einen Unfall hat und dort länger auf einer Intensivstation liegt, bringt hoch resistente Bakterien mit.»
Das gelte auch für Verwundete aus Kriegsgebieten. «Jeder kriegsversehrte Patient, der aus der Ukraine zu uns verlegt wird, hat zwei bis drei Superbugs», sagt Harbarth. Deswegen werden Patienten, die aus diesen Ländern in ein Schweizer Spital verlegt werden, auf resistente Keime untersucht und sofort isoliert.
Der lange Zeit gefürchtete MRSA-Keim, der gegen viele gängige Antibiotika resistent ist, ist in Schweizer Spitälern aber auf dem Rückzug, wie offizielle Daten zeigen. «Als ich vor 20 Jahren nach Genf zurückkehrte, hatten wir fast jeden Tag eine MRSA-Infektion. Mittlerweile sehe ich sie nur noch sehr selten», sagt Harbarth. Gründe sind unter anderem verbesserte Überwachung und Händehygiene.
Und Harbarth weist auf eine weitere gute Nachricht hin: «Die klinische Pipeline füllt sich wieder.» Die Entwicklung neuer Antibiotika nimmt Fahrt auf, auch wenn dahinter nicht die Pharmariesen stecken.
6. Neue Hoffnung
Bakterien sind wie Kinder: Sie machen alles zu ihrem Spielplatz. Es gibt zum Beispiel Bakterien, die sich im Darm von Fadenwürmern tummeln. Diese Fadenwürmer leben im Boden und durchlöchern dort Insektenlarven. Durch diese Löcher schlüpfen die Bakterien aus dem Darm der Fadenwürmer und beginnen im Eiltempo Giftstoffe in die Larven zu pumpen. Zwei Tage später sind sie tot, die Bakterien vertilgen die Überreste und leuchten dabei auch noch wie Glühwürmchen.
In diesen Bakterien entdeckten Forscher vor einigen Jahren das Antibiotikum Darobactin. Es wirkt gegen die gramnegativen Bakterien, gegen die es seit den 1960er-Jahren keine neuen Antibiotika gibt.
Auf der Suche nach neuen Wirkstoffen hatten sich Forscherinnen lange auf Bodenbakterien konzentriert. Immerhin war daraus eines der bisher erfolgreichsten Antibiotika aller Zeiten hervorgegangen, das Streptomyzin von Selman Waksman.
Doch dabei verloren sie die Vielfalt der Lebensräume aus den Augen. Die Mikroorganismen, die in Schwämmen, in Würmern oder in den Tiefen der Meere leben. Sogar den Zahnstein von Neandertalern haben Forschende schon auf Erbgut untersucht, das den Schlüssel für antibiotische Wirkstoffe enthalten könnte. Nun nehmen Forschende diese verschiedenen Lebensräume genauer unter die Lupe und entdecken darin tatsächlich neuartige Kandidaten für Antibiotika.
Nicht nur die Vielfalt der Lebensräume hatten Forscher bis anhin übersehen, sondern auch, dass Krankheitserreger unterschiedlich auf Antibiotika reagieren, je nachdem ob sie im Körper wachsen oder auf einem künstlichen Medium im Labor. «Es kann sein, dass ein Antibiotikum im Labor keine Wirkung zeigt, wohl aber im menschlichen Körper», sagt der Infektionsbiologe Christoph Dehio, der neue Antibiotika am Biozentrum der Universität Basel untersucht. «Wir haben in der Vergangenheit systematisch Dinge übersehen.»
Deswegen lassen Dehio und sein Team die Krankheitserreger unter Bedingungen wachsen, wo Antibiotika einmal wirken sollen: Sie ahmen den menschlichen Körper im Labor nach, mit künstlichem Urin und menschlichen Mini-Geweben.
Neben neuen Antibiotika erforschen Wissenschaftler auch Alternativen wie Antikörper und Phagen. Phagen sind Viren, die Bakterien angreifen. Am Universitätsspital Genf erhielt vor kurzem ein Patient mit Erfolg eine Phagentherapie. Er litt an einer Infektion mit resistenten Bakterien. In den Ländern der ehemaligen Sowjetunion wird diese Therapie schon lange angewendet. Mittlerweile befinden sich gemäss WHO 9 Phagentherapien und 43 Antibiotika in klinischen Studien.
7. Ablasshandel
An innovativen Ideen und Forschergeist mangelt es nicht. Die treibenden Kräfte sind Start-ups sowie kleine und mittlere Biotech-Unternehmen. Aber um ein Medikament auf den Markt zu bringen, braucht es Studien an mehreren Spitälern mit Tausenden Patienten. «Diese Phase der klinischen Entwicklung wird sehr teuer», sagt Dehio.
Die meisten grossen Pharmafirmen, die diese Aufgabe stemmen könnten, sind mittlerweile ausgestiegen. Stattdessen haben sie einen Fonds gegründet und ihn mit einer Milliarde Dollar bestückt. Aber das sei viel zu wenig Geld, sagt Dehio. «Letztlich war das eine Art Ablasshandel, um sich aus der wirtschaftlich wenig interessanten Antibiotikaentwicklung verabschieden zu können.»
In der Pharmaindustrie gilt die Daumenregel: Für ein neues Medikament braucht es 100 Kandidaten. Dazu: Zeit und Geld. 10 bis 15 Jahre und 10 Milliarden Dollar verschlingt ein neuer Wirkstoff in der Regel auf dem Weg vom Labor auf den Markt. Für die Firmen ein hohes Risiko. Doch der Lohn ist gering. Denn schliesslich sollen neue Antibiotika nur sehr sparsam eingesetzt werden.
Den Rückzug der Pharmafirmen bezeichnet die ehemalige Chefmedizinerin Englands, Sally Davies, als kurzsichtig. Wenn die Antibiotika nicht mehr wirkten, würden die Firmen auch keine lukrativen Krebstherapien mehr verkaufen können, warnt sie in einem Dokumentarfilm. Chemotherapien machen Patientinnen anfälliger für Infektionen und sind auf wirksame Antibiotika angewiesen. Die Politik müsse die Pharmaindustrie zwingen, ihr Verhalten zu ändern, sagt Davies.
Ein Ansatz ist, den Pharmafirmen Abnahmegarantien zu geben, ähnlich wie damals während des Penizillin-Projekts. In Grossbritannien läuft gerade der Pilot eines sogenannten Netflix-Modells. Die Regierung schliesst ein Abonnement bei einer Firma für einen festgelegten Zeitraum ab. Das soll die Menge eines verkauften Medikaments von der Vergütung der Pharmafirmen entkoppeln. Beispielsweise erhält Pfizer 10 Millionen Pfund pro Jahr über 10 Jahre für unlimitierten Zugang zu einem seiner Medikamente in England.
Weltweit stecken Dutzende Initiativen Geld in neue Therapien, sei es von staatlicher Seite oder von Non-Profit-Organisationen.
Die Schweiz würde auch als Pharmastandort enorm von solchen Initiativen profitieren, doch der Bund beteilige sich bisher nicht an solchen Initiativen, bemängelt Resistenzforscher Dehio. Auch andere Wissenschaftler kritisieren, die Schweiz müsste jährlich statt wie bisher 10 Millionen in Zukunft rund 50 bis 100 Millionen Franken investieren.
Ändern könnte sich dies demnächst mit der Revision des Epidemiengesetzes. Die Vorlage enthält zwei Artikel, die dem Bundesrat erlauben würden, explizit internationale Initiativen zu unterstützen. «Das ist ein wichtiges Gesetzesvorhaben», sagt Dehio. «Wir müssen jetzt dafür Sorge tragen, dass die Revision auch wirklich so zustande kommt.»
Im September ist ein zweites «High-Level-Meeting» der Vereinten Nationen zu Antimikrobieller Resistenz geplant. Ähnlich wie bei den Klimagipfeln erhofft man sich, dass sich die Staatengemeinschaft auf gemeinsame Massnahmen und Ziele einigt. Fast ein ganzes Jahrhundert nach der Entdeckung des ersten Antibiotikums.
Mit ihm hatten der Chemiker Ernst Chain und seine Kollegen einst vier Mäusen das Leben gerettet. Nur wenige Monate nach diesem Experiment hatte Chain auch verstanden, warum das Penizillin so unstabil war. Die ursprüngliche Schimmelpilzkultur war verunreinigt. Sie enthielt ein resistentes Bakterium, das Penizillin zerstückeln konnte. Noch bevor der Stoff je einem Menschen das Leben rettete, hatte Chain die erste Antibiotikaresistenz entdeckt.
Wenige Jahre später erhielt er zusammen mit seinen Kollegen Howard Florey und Alexander Fleming den Nobelpreis in Medizin.
Damals wurde der Wirkstoff für seine «heilende Wirkung bei verschiedenen Infektionskrankheiten» gefeiert. Die Warnungen, die mit seinem Einsatz verbunden waren, überhörte man.
«Es besteht die Gefahr, dass die Mikroben lernen, resistent gegen Penizillin zu werden», sagte Alexander Fleming in seiner Dankesrede 1945. «Und wenn die Mikrobe einmal resistent ist, bleibt sie auch für lange Zeit resistent. Verlässt sie dann den Körper, könnte sie andere Menschen infizieren, ohne dass Penizillin helfen kann.»