
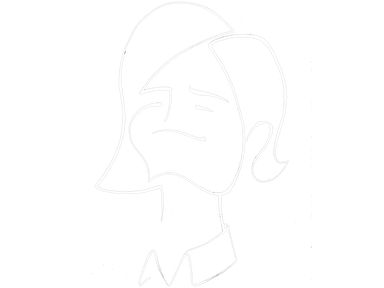
Die Schweiz braucht Strassburg
Das Klima-Urteil löst massive Abwehrreflexe aus. Zu Unrecht.
Von Daniel Binswanger, 13.04.2024
Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Überzeugen Sie sich selber: Lesen Sie 21 Tage lang kostenlos und unverbindlich Probe:
Seniorinnen schreiben Justizgeschichte: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) verurteilt die Eidgenossenschaft und setzt sie unter Druck, die Erreichung der Klimaziele gemäss Pariser Abkommen konsequent und mit einem schlüssigen Konzept zu verfolgen. Wie reagiert die Schweizer Presse? Mit Empörung, Bedenken, Lamento.
Das Problem, so lernen wir verblüfft, ist nicht die ungenügende Klimapolitik der Eidgenossenschaft. Weit gefehlt: Das Problem ist die «Einmischung der fremden Richter».
Diese Reaktionen sind nicht weniger ernst zu nehmen als das Strassburger Urteil selbst. Der Entscheid des EGMR ist ein ermutigendes Zeichen: Eine wirksame Klimapolitik hat anerkanntermassen so grosse Dringlichkeit bekommen, dass ihre Vernachlässigung als Verstoss gegen den Grundrechtsschutz verstanden werden muss – beileibe nicht nur in Strassburg, aber nun erstmalig mit dieser Tragweite.
Die Reaktionen in den Schweizer Medien hingegen sind nicht ermutigend: Sie zeigen, dass das illiberale Verständnis von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, das die SVP 2018 mit der Selbstbestimmungsinitiative erfolglos in der Bundesverfassung festzuschreiben versucht hat, mindestens im Schweizer Mediendiskurs inzwischen quasi mehrheitsfähig geworden ist. Nun müssen wir allen Ernstes wieder über eine Kündigung der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) debattieren. Zahlreiche Stimmen möchten zwar nicht ganz so weit gehen, bringen für die «Mühe» der Schweizer Politik mit den «Einmischungen aus Europa» jedoch allergrösstes Verständnis auf.
Das ist ein Zeichen bedrohlicher demokratiepolitischer Regression. Das gilt umso mehr, als die klimapolitische Erweiterung des Menschenrechtsschutzes zwar in der Tat eine Neuinterpretation von Grundnormen darstellt, die juristisch unterschiedlich bewertet werden kann, aber eins ganz gewiss nicht ist: eine überzogene Einschränkung der direktdemokratischen Entscheidungsgewalt des Schweizer Souveräns.
Was besagt das Urteil in der Sache? Es stipuliert eine menschenrechtlich begründete Klimaschutzpflicht des Schweizer Staates gegenüber besonders vulnerablen Bevölkerungsgruppen, im konkreten Fall gegenüber betagten Bürgerinnen, die überdurchschnittlich unter der Klimaerwärmung leiden. Es begründet dies unter anderem damit, dass die Schweiz das Pariser Abkommen ratifiziert hat und deshalb dazu verpflichtet ist, auch die zeitgerechte Umsetzung des Abkommens zu garantieren. Was sie unbestreitbar bisher nicht getan hat.
In den Schweizer Medien ist nun allenthalben zu lesen, der EGMR setze sich damit über einen direktdemokratischen Volksentscheid hinweg, schliesslich habe der Souverän im Juni 2021 das CO2-Gesetz in Bausch und Bogen verworfen, das Massnahmen zur Erreichung der Pariser Ziele durchsetzen wollte. Wie kann Strassburg der Schweizer Bevölkerung etwas aufzwingen wollen, was diese explizit zurückgewiesen hat?
Diese Argumentation ist allgegenwärtig – und vollkommen absurd. Wie Republik-Autor Elia Blülle schon dargelegt hat: Das CO2-Gesetz wurde 2021 zwar in der Tat verworfen, doch das Klimaschutzgesetz wurde 2023 deutlich angenommen. Die Schweiz sei mit diesem Plebiszit zum ersten Land der Welt geworden, in dem das Netto-null-Ziel bis 2050 und damit das Pariser Klimaabkommen mit einem direktdemokratischen Referendum bestätigt worden sei, so tönte es damals voller Stolz. Das Urteil des EGMR reinterpretiert die Implementierung des Pariser Netto-null-Ziels nun zusätzlich als Gebot des Menschenrechtsschutzes. Es gibt nicht den geringsten Gegensatz zum manifestierten Schweizer Volkswillen.
Der EGMR legt lediglich den Finger auf den wunden Punkt, nämlich dass im Klimaschutzgesetz keine genügenden Massnahmen festgeschrieben sind, um die anvisierten Ziele zu erreichen, sodass weiterhin Handlungsbedarf besteht und bisher offenbleibt, ob die Eidgenossenschaft die Klimapolitik, zu der sie sich selbst bekannt hat, auch tatsächlich umsetzen wird.
Das Ministerkomitee des Europarats wird nun beobachten müssen, ob die Eidgenossenschaft ihre selbst gestellte Aufgabe angeht. Auf welchem Weg die Schweiz das tut, lässt der EGMR bewusst vollkommen offen. Das ist ein politischer Entscheid, rechtlich einklagbar ist nur, dass es irgendwie geschehen muss. Zwar wäre es theoretisch denkbar, dass der Schweizer Souverän in Zukunft Entscheide fällen wird, die zu einer Umsetzung der beschlossenen Politik im Widerspruch stehen – schon im Juni könnte mit der Ablehnung des Mantelerlasses für eine sichere Stromversorgung eine solche Normenkollision produziert werden. Vorderhand jedoch ist von einer Strassburger Einschränkung oder Desavouierung direktdemokratischer Entschlüsse rein gar nichts zu sehen.
Warum echauffieren sich die Schweizer Öffentlichkeit und die bürgerlichen Parteien über eine Kollision von Plebiszit und Richterrecht, die gar nicht stattgefunden hat? Natürlich: Zu Widersprüchen zwischen direktdemokratischen Beschlüssen und der Menschenrechtskonvention kann es immer wieder kommen. Dem Mehrheitsprinzip eine Grenze zu setzen, ist der Sinn von Grundrechten. Hier aber wird ein Problem herbeigeredet.
Die Motive dürften simpel sein: Aufgrund der wieder verstärkten politischen Zugkraft der Migrationspolitik sind besonders im Bereich des Asylwesens Angriffe auf die Menschenrechtskonvention inzwischen erstaunlich salonfähig geworden. «Wer braucht noch die Menschenrechte?» titelte die «NZZ am Sonntag» im letzten November frisch von der Leber weg einen Artikel zur britischen Debatte über die Ausschaffungspraxis des Königreichs. Einzelne Strassburger Urteile mögen zu absolut legitimen Diskussionen Anlass geben. Die richtige Dosierung von Interventionen der Judikative kann man immer unterschiedlich beurteilen. Inzwischen ist die Dauerkritik gegen «aktivistisches Richterrecht» jedoch zu einem Selbstläufer geworden.
Mit dem Strassburger Urteil ist nun neben der migrationspolitischen auch noch die klimapolitische Front aufgegangen. Das passt zum Agendawandel des Rechtspopulismus, der – in den USA, in Deutschland und auch in der Schweiz – neben der Migration verstärkt die Klimapolitik als Reizthema mit Mobilisierungspotenzial entdeckt. Es ist in der Tat damit zu rechnen, dass sich der Widerstand gegen den Schutz von Grundrechten durch internationale Konventionen und Gerichte noch einmal verstärken wird.
Dass die SVP nun in dieses Horn bläst, ist weder überraschend noch besonders beunruhigend. Beunruhigend ist, dass aus der FDP keine klaren Signale mehr dagegen kommen. Dass die NZZ das Strassburger Urteil als antidemokratisch disqualifiziert: «Mit Demokratie hat das nichts zu tun.» Der «Tages-Anzeiger» kommt zur erstaunlichen Feststellung: «Die Demokratie gerät unter Druck.» Der Volksrechtsfetischismus ist inzwischen derart ausgeprägt, dass die «liberalen» Instanzen in unserem Land offenbar nur noch eine anämische Minimaljudikative tolerieren wollen.
Der Bocksgesang des Anti-Strassburg-Gemäkels wird weiter anschwellen. In einem gefestigten liberalen Rechtsstaat würde er im Keim erstickt. Natürlich war die Schweiz auch schon vor ihrem Beitritt zur Menschenrechtskonvention eine alte und solide Demokratie, und natürlich verfügt sie über eine eigene Verfassung, die ihrerseits einen Grundrechtsschutz garantiert. Selbst wenn die Schweiz die Menschenrechtskonvention tatsächlich kündigen würde, wäre nicht damit zu rechnen, dass der Schweizer Rechtsstaat unterginge. Dennoch ist das Kokettieren mit der Kündigung beschämend.
Um nur die drei wichtigsten Gründe zu nennen: Wenn weit herkommende und beispielhafte Demokratien wie die Schweiz (oder Grossbritannien) allen Ernstes darüber nachzudenken beginnen, die EMRK zu kündigen, sendet dies erstens ein verheerendes Signal aus an die jungen und in der Tat labilen Demokratien in Osteuropa. Nichts könnte absurder sein in einer Zeit, in der die liberalen europäischen Verfassungsstaaten sich gegen die Bedrohung durch die russische Expansion und gegen sich überall manifestierende autoritäre Tendenzen zur Wehr setzen müssen. Die europäische Wertegemeinschaft muss sich solidarisch zeigen – gesellschaftlich, politisch, militärisch. Und in dieser Situation treten wir eine neue Debatte los über die Demokratiefeindlichkeit des Menschenrechtsgerichtshofs? Es ist vollkommen verantwortungslos.
Zweitens zeugt die Behauptung, eine direkte Demokratie wie die Schweiz werde durch den Europäischen Gerichtshof nur gegängelt und sei gar nicht auf ihn angewiesen, von beschämender Geschichtsblindheit. Die Schweiz zeichnet sich aus durch ihre Institutionen der direkten Demokratie – hat aber auch eine Geschichte der gravierenden Diskriminierungen und der Missachtung von Minderheitenrechten. Zum einen ist hier natürlich das Frauenstimmrecht zu nennen, dessen Einführung wir nicht dem Schweizer Verfassungsrecht, sondern der Europäischen Menschenrechtskonvention verdanken. Zum anderen und nicht weniger prominent müssen die fürsorgerischen Zwangsmassnahmen angeführt werden.
Nach Schweizer Recht konnten randständige Personen (Alkoholiker, Prostituierte, verarmte Personen, alleinerziehende Mütter) oder Angehörige ethnischer Minderheiten (Jenische) einigermassen willkürlich in Heimen oder Strafanstalten «versorgt» oder es konnte ein Kindsentzug angeordnet werden. Auch diesen barbarischen Verstössen gegen den Minderheiten- und den Grundrechtsschutz setzte erst der Beitritt zur Menschenrechtskonvention ein Ende. Wie man angesichts dieser Tatsachen allen Ernstes behaupten will, zwischen dem ausgeprägten Mehrheitsprinzip der Direktdemokratie und der Garantie der Menschenrechte bestehe gar kein Gegensatz, ist einigermassen schleierhaft.
Drittens ist es die Menschenrechtskonvention, die der Schweiz auch auf Bundesebene wenigstens partiell zu einer Verfassungsgerichtsbarkeit verhilft. Zu den grossen Schwächen des Schweizer Rechtssystems gehört die andauernde Besonderheit, dass mit einfacher Mehrheit von Volk und Ständen jeder Unsinn in die Verfassung geschrieben werden kann, auch dann, wenn es zu einer Kollision mit Grundrechten kommt. Begründet wird diese Inkohärenz mit der Unantastbarkeit der Volksrechte. Nur die Menschenrechtskonvention hat gesicherten Vorrang vor neuen Gesetzen oder Verfassungsartikeln und setzt so dem Initiativrecht gewisse Grenzen.
Gerade die Schweizer Direktdemokratie ist also angewiesen auf das Strassburger Gericht – viel mehr als ein Land mit starker Verfassungsgerichtsbarkeit wie etwa die Bundesrepublik Deutschland.
Das Klima-Urteil von Strassburg wird die Schweiz dazu zwingen, die Politik, die sie selbst schon beschlossen hat, tatsächlich umzusetzen. Das ist von sehr überschaubarer Dramatik – und müsste jedem Eidgenossen, der daran glaubt, der Volkswille dürfe nicht missachtet werden, das Herz höherschlagen lassen. Die permanente Infragestellung der Menschenrechtskonvention hingegen richtet massiven politischen Schaden an. Sie redet de facto einem Mehrheitsprinzip das Wort, das im vermeintlichen Namen der Demokratie den Rechtsstaat schwächt. Dass diese Diskurse sich banalisieren, tut niemandem einen Gefallen. Ganz bestimmt nicht der Schweizer Demokratie.
Illustration: Alex Solman