
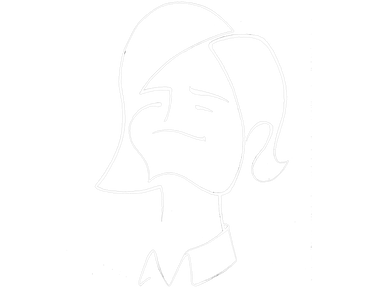
Die Credit Suisse und der Kredit der Schweiz
Den Bankern die zweistelligen Millionen-Boni. Uns allen der Schaden und die Kosten. Nach der Finanzkrise wurden einschneidende Massnahmen ergriffen, damit sich das ändert. So dachte man.
Von Daniel Binswanger, 18.03.2023
Journalismus kostet. Dass Sie diesen Beitrag trotzdem lesen können, verdanken Sie den rund 27’000 Leserinnen, die die Republik schon finanzieren. Wenn auch Sie unabhängigen Journalismus möglich machen wollen: Kommen Sie an Bord!
Ein albtraumhaftes Déjà-vu: Erschütterungen, die ihren Ausgangspunkt im amerikanischen Finanzsystem haben, erreichen eine Schweizer Grossbank, die ihre Risiken nicht im Griff hat, mit Inkompetenz und Grössenwahn in eine Schieflage geführt worden ist, sich durch unlauteres Geschäftsgebaren hervortut. Plötzlich explodieren die Versicherungsprämien für die Kredite, die sie aufnehmen will, die Investoren bekommen Panik, die Bank findet am Markt kein Geld mehr.
Jetzt kann nur noch der Staat helfen, der einspringt mit Hilfskrediten von 50 beziehungsweise 60 Milliarden Franken. Zwar haben die Bankerinnen in den Jahren vor dem Absturz luxuriöse Boni bezogen, deren Gesamtsumme ihrerseits in die Milliarden geht. Die Verluste aber muss die Allgemeinheit auffangen.
So war es 2008 bei der UBS, und so ist es nun bei der Credit Suisse, der anderen Schweizer Grossbank. Man könnte glauben, dass wir nichts gelernt, nichts verändert, nichts verbessert haben seit der Finanzkrise. Dieser Eindruck trügt auf finanztechnischer Ebene: Der UBS-Fall war systemisch und strukturell ganz anders geartet als der Fall der Credit Suisse. Auf einer politischen, gesellschaftlichen, kulturellen Ebene trügt dieser Eindruck jedoch überhaupt nicht.
Es ist erneut eine Geschichte von Ruchlosigkeit, überzogener Gier und falschen Anreizen. Von blinder politischer Komplizenschaft und nicht existierender Haftbarkeit. Das Bankgeschäft ist heute wesentlich strenger reguliert, die Eigenmittelquoten liegen deutlich höher als 2008. Und trotzdem wiederholt sich die Geschichte.
Die masters of the universe bleiben offensichtlich unantastbar: Sie verdienen weiterhin absurde Millionengehälter. Sie richten weiterhin gigantischen Schaden an. Sie müssen für rein gar nichts geradestehen. Und werden von staatlichen Institutionen gerettet, sobald die Dinge aus dem Ruder laufen.
Worin unterscheidet sich 2023 von 2008? Damals wurde das Finanzsystem durch eine massive Systemkrise erschüttert. Weltweit waren die Banken mit viel zu wenig Eigenmittelreserven ausgestattet, und die Subprime-Blase in den USA führte dazu, dass zahlreiche Finanzinstitute, nicht nur in den USA, sondern auch in Europa und in der Schweiz, riesige Positionen in ihren Büchern hatten, deren Wert innert kürzester Zeit kollabierte und die Banken faktisch insolvent werden liess.
Allein die UBS musste im Jahr 2007 und im ersten Halbjahr 2008 Wertberichtigungen von über 60 Milliarden Dollar vornehmen. Vermeintlich sichere Anlagen wurden über Nacht zu «Schrottpapieren», und Eigenkapital, um die Verluste aufzufangen, war viel zu wenig vorhanden. Also musste die Eidgenossenschaft die UBS retten: zum einen, indem sie Kapital in die marode Bank einschoss, zum anderen, indem sie der UBS die Schrottpapiere abkaufte, für maximal 54 Milliarden Dollar (de facto war es etwas weniger).
Die UBS war jedoch weit davon entfernt, die einzige Grossbank zu sein, die mit staatlichem Geld gerettet werden musste – oder Pleite machte. Nachdem die US-Regierung Lehman Brothers in den Konkurs hatte gehen lassen, musste sie einen 700-Milliarden-Dollar-Fonds auflegen, um viele andere Grossbanken und Finanzinstitute mit einem Bail-out zu retten. Allein der Versicherer und Finanzdienstleister AIG wurde mit 180 Milliarden unterstützt. Er ist heute noch im Geschäft. Auch in Europa nahmen zahlreiche Banken staatliche Hilfe in Anspruch. In Deutschland wurden die Commerzbank und die Hypo Real Estate mit 18,2 beziehungsweise 9,8 Milliarden Euro aufgefangen. Die niederländische ING erhielt 10 Milliarden Euro, die britische Royal Bank of Scotland wurde mit 45,8 Milliarden Pfund gerettet.
Diese Liste liesse sich fortsetzen. Die UBS hat 2008 nichts kommen sehen und schwer versagt. Doch den meisten anderen Grossbanken ging es genauso. Genau das machte die Finanzkrise so gravierend. Der damaligen UBS-Führung kann man jedoch nicht vorwerfen, sie sei fahrlässiger gewesen als die Konkurrenz.
Genau hier liegt sowohl die gute wie auch die schlechte Neuigkeit: 2023 ist es umgekehrt. Obwohl das gesamte globale Bankensystem durch die steigenden Zinsen und die schlechten ökonomischen Perspektiven in Mitleidenschaft gezogen wird – und in den USA nun auch schon zwei grössere Finanzinstitute in den Konkurs getrieben worden sind und weitere Finanzhäuser gestützt werden müssen –, kann von einem Systemkollaps bis anhin nicht die Rede sein.
Wir haben es hier nicht mit einer generellen Systemkrise zu tun – sondern mit massivem individuellem Versagen. Dem Versagen des Credit-Suisse-Managements.
Was die Credit-Suisse-Führung zerstört hat, ist das Vertrauen, nicht die Bilanz. Eigentlich ist die Bank gesund – nur glaubt ihr das keiner mehr. Technisch ausgedrückt: Die CS hat eine Liquiditäts- und keine Insolvenzkrise. Ihre Guthaben sind immer noch grösser als ihre Schulden, die sie eigentlich problemlos bedienen kann. Dennoch will ihr niemand mehr Geld leihen. Also muss die Schweizerische Nationalbank (SNB) die Liquidität garantieren.
Die Nationalbank wird mit Sicherheit ihre Milliarden zurückbekommen, weil die CS den Kredit mit erstklassigen Anlagen absichern kann. 2008 übernahm die Nationalbank von der UBS die Schrottobligationen aus dem amerikanischen Subprime-Markt. Von der CS bekommen die Währungshüter jetzt erstklassige Schweizer Hypotheken als Sicherheit. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Handelt es sich bei den SNB-Milliarden also gar nicht um Staatshilfe, sondern lediglich um eine Liquiditätsüberbrückung?
Das ist natürlich, was die Bankenfreunde jetzt auf allen Kanälen kommunizieren – und es ist nicht die ganze Wahrheit. Erstens lassen sich Liquiditäts- und Insolvenzkrisen niemals völlig trennscharf voneinander abgrenzen. Wie die Bilanz der CS Stand heute genau aussieht, wissen wir nicht, weil sie bestimmt in den letzten Tagen erstklassige Anlagen unter Preis verkauft hat, um an Geld zu kommen. Zudem sind sowohl Liquiditäts- als auch Insolvenzkrisen immer nur punktuelle Ereignisse. Auch Staatshilfe kann eine insolvente Bank, wenn alles gut geht, zu einem späteren Zeitpunkt zurückbezahlen. Die UBS hat das mit den Hilfsgeldern von 2008 bewiesen – und alles wieder abgegolten.
Entscheidend ist jedoch, dass wir die Bedingungen der aktuellen CS-Liquiditätshilfe nicht kennen. Alles hängt am Zinssatz: Nach Lehrbuch müsste dieser Zins am oberen Ende eines normalen Marktzinses sein. Die Bank, der geholfen wird, soll Geld erhalten, aber keine Vorzugsbedingungen gegenüber dem Markt. Ob dies beim jetzigen Rettungsdeal der Fall ist, scheint mehr als zweifelhaft. Erstens kommuniziert die SNB nicht transparent, und zweitens will die CS für 3 Milliarden ihre eigenen auf dem Markt befindlichen Obligationen zurückkaufen. Das deutet darauf hin, dass die SNB ihr einen Vorzugszins gewährt. Das wäre nichts anderes als eine potenziell sehr saftige Staatshilfe.
Aber was ist eigentlich geschehen? Wie kann eine der traditionsreichsten, international führenden Grossbanken, die zudem vergleichsweise gut über die Finanzkrise gekommen ist, dermassen im Schlamassel enden? Die Antwort ist atemberaubend simpel: Die Credit Suisse hat das Vertrauen verspielt. Deshalb verliert sie zunehmend ihre Kunden und deren Gelder. Und jetzt auch noch die Kreditwürdigkeit.
Über die letzten Jahre ist die CS von derart vielen Skandalen, Rechtsfällen und Fehlinvestitionen erschüttert worden, dass man kaum mehr die Übersicht behalten kann. Begnügen wir uns mit einer knappen Best-of-Liste:
Mit Archegos und Greensill stürzten der Grossbank im Frühjahr 2021 zwei Anlagefonds ab, die sie an Grosskunden verkaufte. Es erwies sich, dass die Produkte mit massivem Leverage arbeiteten und absolut halsbrecherische, hoch riskante Positionen umfassten. Nach heutigem Stand verliert die Bank rund 7 Milliarden Dollar mit diesen beiden Abenteuern.
Oder die Affäre von Ende 2021, die Regulierungsbehörden rund um den Globus aufscheuchte: Offensichtlich ist die CS sehr stark engagiert in der Kreditfinanzierung von Oligarchen-Superjachten und Oligarchen-Privatflugzeugen. Weil sich Ende 2021 abzeichnete, dass die Besitzer dieser Luxusspielzeuge schon bald auf Sanktionslisten landen, die Jachten beschlagnahmt werden und die Kredite potenziell verloren gehen, betrieb die CS ein bisschen kreatives financial engineering: Sie verbriefte die Kredite und versuchte, sie an risikofreudige Hedgefonds zu verticken.
Als die Sache aufflog, weil die CS nervös wurde und ihre Geschäftspartnerinnen aufforderte, Unterlagen zu dem Konstrukt doch bitte zu vernichten, wurde ein weiteres Mal klar, wie präsent die Schweizer Grossbank im Russland-Geschäft ist – und dass sie keinerlei Berührungsängste hat bei der Wahl ihrer Kunden.
Oder der Moçambique-Skandal: Die CS vermittelte 2013 die Hälfte eines 2-Milliarden-Dollar-Kredites für das Entwicklungsland im südlichen Afrika, mit dem unter anderem eine Thunfischfang-Flotte hätte finanziert werden sollen. 2 Milliarden waren damals etwa 12 Prozent des gesamten Bruttoinlandprodukts von Moçambique. Offenbar bemerkten die CS-Banker dennoch nicht, was für eine wüste Farce das in der Theorie von der Regierung garantierte Unternehmen war: Das ganze Geld versickerte in obskuren Kanälen der Korruption. Als das aufflog, zogen sich sämtliche internationalen Geldgeber aus dem Land zurück – mit gravierenden Folgen für die Bevölkerung. Moçambique ist in eine schwere Wirtschaftskrise gestürzt, das Staatsbudget halbierte sich, das ohnehin rudimentäre Bildungs- und Gesundheitssystem wurde massiv beschädigt. Alles unter aktiver Mithilfe des Paradeplatzes.
Man könnte die Liste fast beliebig verlängern: Die Skandale und Rechtsfälle scheinen unerschöpflich (die «Financial Times» hat daraus gutes Kino gemacht). Und dann kommen natürlich, nicht als Nebenaspekt, sondern als alles bestimmende Anreizstruktur, die Bonus-Exzesse hinzu. Brady Dougan verdiente in seinen acht Jahren an der CS-Spitze rund 160 Millionen Franken. Tidjane Thiam in seinen fünf Jahren rund 90 Millionen. Die Aktienkursentwicklung in der Zeit war ein Desaster, die Betriebskultur, die sich etablierte, hat sich nun definitiv offenbart. Dougan und Thiam stehen in der Verantwortung. Ganz zu schweigen von Verwaltungsratspräsident Urs Rohner, der für sein zehnjähriges Mandat von 2011 bis 2021 rund 50 Millionen kassiert haben soll.
Ist die CS eine Schweizer Traditionsbank oder eine kriminelle Organisation? Dieser Unterschied scheint geringfügiger zu sein, als man es jemals für möglich gehalten hätte. Und hier sind wir vermutlich bei der zentralsten, schmerzlichsten und dringlichsten Frage, die diese neue Grossbankenkrise in den Raum stellt: Was erzählt die Credit Suisse über die Schweiz?
Wohl kein anderes Unternehmen ist so eng und breitflächig mit dem Schweizer Wirtschaftsleben verzahnt wie der omnipräsente Geschäftskreditgeber. Kein anderes Unternehmen repräsentiert mit dieser Macht die Geschichte der Schweizer Wirtschaftselite und der Zürcher Gesellschaft – von der Gründung 1856 durch Alfred Escher bis hin zu den Wirtschaftskapitänen Rainer Gut und Walter Kielholz, die nicht nur Bankiers gewesen sind, sondern zentrale Führungsfiguren des helvetischen Establishments.
Was sagt die Credit Suisse über den Schweizer Kredit – die moralische, juristische, geschäftliche, kulturelle Glaubwürdigkeit, die wir heute haben? Wir erleben nicht ein globales Systemversagen, sondern das singuläre Versagen einer Geschäftskultur. Der unseren.
Wir sind das Land, das sich im Russland-Ukraine-Krieg hinter einer vorgeschobenen Neutralität versteckt und keinerlei Verantwortung übernimmt. Das Land, das sich in Europa ohne Not ins Offside manövriert und mit nationalistischem Eigensinn seine Wirtschaftsbeziehungen beschädigt. Und jetzt sind wir das Land, das in seinem angestammten, traditionsreichsten Geschäftsfeld eine Liederlichkeit an den Tag legt, die man schlicht nie für möglich gehalten hätte.
Wird die CS eigenständig überleben? Es sieht nicht gut aus, aber wir wissen es nicht. Schon heute gewiss ist nur, dass Tausende von CS-Mitarbeiterinnen ihren Job verlieren werden. Und dass sich in diesem Land ganz dringend etwas ändern muss.
Illustration: Alex Solman